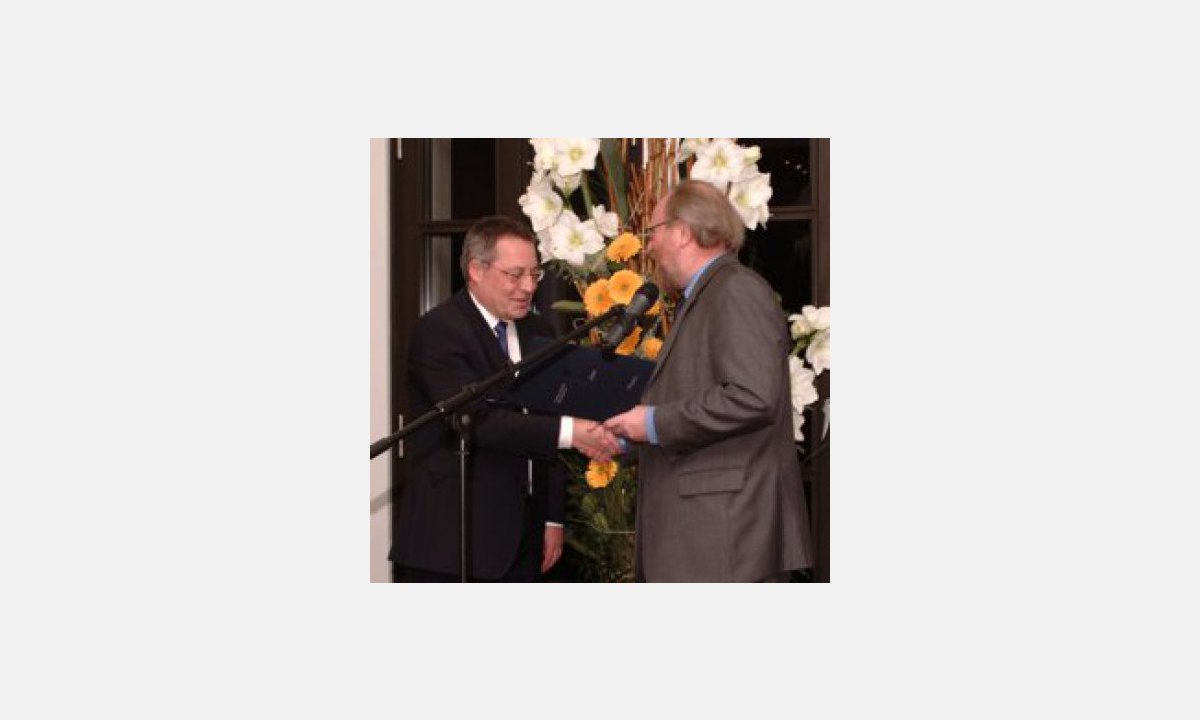Sehr verehrter Herr Bundestagspräsident,
sehr verehrte Frau Nogossek,
verehrter Herr Zernack, verehrter Herr Lemberg,
sehr verehrte Damen und Herren!
Sie können mir glauben, wie überaus glücklich ich war, als im Mai der Anruf von Frau Dr. Nogossek vom Deutschen Kulturforum östliches Europa kam. Wie aus heiterem Himmel. Und man fragt sich, ob man es verdient hat. Ich danke den Juroren, die die Entscheidung getroffen haben. Ich danke der Auszeichnung, die ja immerhin einem »Gesamtwerk« gilt, das hoffentlich noch nicht abgeschlossen ist. Und ich danke vor allem Herrn Lemberg. Herr Lemberg steht an einer bedeutenden Station meines Lebens. Er gehörte der Kommission an, die damals, im Jahre 1981, die zu jener Zeit spärlichen und handverlesenen Austauschwissenschaftler für die Sowjetunion auszuwählen hatte. Wäre die Entscheidung damals anders ausgegangen, ich weiß nicht, was aus mir und meiner Wendung nach Osten geworden wäre. Am stärksten an der Entscheidung der Jury hat mich aber beeindruckt, dass sie eine Doppelentscheidung, sozusagen einen Doppelbeschluss riskiert hat: beide Preise gingen an die Viadrina. Das war, wie ich finde, eine akzentuierte, eine mutige Entscheidung. Sie sagt auch, dass für die Ausgezeichneten etwas auf dem Spiel steht: Sie könnten die hohen Erwartungen enttäuschen. Ich sehe in der Doppelauszeichnung, die auf die Viadrina gefallen ist, eine Ermutigung, aber auch eine sehr massive Aufforderung: Wir erwarten noch etwas.
Ich gehöre zu denen, wohl den meisten, für die »Dehio« nur ein Name, ein Kürzel ist: der Verfasser des Handbuchs der deutschen Kunstdenkmäler, und ich wusste natürlich, dass er ein Mann aus dem Deutschen Osten war, ein deutschbaltischer Name mit großem Klang. Aber nicht viel mehr. In diesem Jahr hat Peter Betthausen eine umfassende Dehio-Biographie vorgelegt und jeder, der will, kann sich ein detailliertes Bild machen. Es gibt vieles, was daran eindrucksvoll und beeindruckend ist. Die Biographie eines deutschen Gelehrten, wie ihn Fritz Ringer porträtiert hat, als er über die deutschen Mandarine schrieb. Die Gediegenheit des 19. Jahrhunderts, wie sie auf den Porträtaufnahmen mit dem eleganten Filzhut und den steifen Kragen hervortritt; die Behaglichkeit des Interieurs der von ihm erbauten Villa in der Spachstraße in Straßburg; Dehio im Kreise seiner Studenten auf Exkursion, Dehio unterwegs auf einer seiner Kunstreisen in Italien oder Südfrankreich, Dehio im Kreis seiner Familie. Gruppenaufnahmen mit einem deutschen Bilderbuchgelehrten, ein Prototyp des reifen 19. Jahrhunderts, dessen Lebensmitte noch vor den Jahren 1914 lag und als die Künstlernatur, als eminenter Zeichner und Aquarellist, was ihm innerhalb der akademischen Welt einen Sonderstatus einräumte. Georg Dehio ist vieles: die bürgerliche Existenz, der Autor eines kohärenten und kompakten Werkes – Geschichte der kirchlichen Baudenkmäler; Geschichte der deutschen Kunst; Handbuch der deutschen Baudenkmäler – ein Vielreisender und gewiss auch »eine komplizierte Natur«, wie er von sich selbst sagte. Aber all dies zusammengenommen ist nicht das, was mich an Dehio fasziniert. Es ist etwas anderes. Ich möchte es bezeichnen als Weltläufigkeit, die den Deutschen der Vorweltkriegszeit einmal eigen war und die im 20. Jahrhundert so gründlich ruiniert worden ist. Da kommt vieles zusammen: eine Biographie, die 1850 in der Breitstraße, heute Laistraße in Reval, dem heutigen Tallinn, beginnt, und über Göttingen, Bonn und München erst nach Königsberg und dann nach Straßburg führt, und schliesslich in einen Lebensabend in Tübingen, wo er 1932 stirbt. Dehios Stationen messen einen Raum aus, der seither mehr als einmal in Trümmer gelegt worden ist, in dem sich zu bewegen, aber einmal selbstverständlich gewesen war. Dehio, das kann man leicht aus seinen Schriften entnehmen, war ein Deutschbalte sans phrase, mit ziemlich ausgeprägtem, fast herrschaftlichem Selbstbewußtsein, ohne eine spezielle Neigung weder für die Esten noch für die Russen, in deren Umgebung er aufwuchs. Dehio mochte Petersburg nicht, und auch später zog er den französischen Westen und vor allem Italien dem mittleren und östlichen Europa deutlich vor: Dehio war niemals in Prag, Königsberg war für ihn gleichsam ein Ort der Verbannung. Aber das Entscheidende, ganz unabhängig von seinen Vorlieben oder Idiosynkrasien: Dehio gehörte einer noch ungeteilten Welt, einem Europa vor der Teilung an. Er schätzte vielleicht das östliche Europa nicht sonderlich – das läßt sich leicht an der spärlichen Berücksichtigung des deutschen Ostens und der östlichen Europa in seiner Kunstgeschichte zeigen –, aber er kannte es wenigstens, es lag im Lebenshorizont eines Deutschen im alten Vorkriegseuropa. Das Verschwinden dieser Selbstverständlichkeit ist, so möchte ich das formulieren, das kulturelle Hauptresultat des 20. Jahrhunderts. Und ihre Rückgewinnung vielleicht das Hauptresultat von gut einem halben Jahrhundert Nachkriegszeit, möchte man hinzufügen. Die Selbsterständlichkeit, mit der Dehio und dann seine Familie über den europäischen Kontinent hinweg sich bewegt, ist etwas, was wahrzunehmen, sich lohnt. Aus Reval nach München, München als selbstverständlicher Ankerplatz deutschbaltischer Studenten; die Initiation in Göttingen, die sich wenig von der in Dorpat/Tartu unterschied; die Lese- und Studiergewohnheiten, die Konkurrenz der Universitäten im deutschsprachigen Raum, die Homogenität einer Wissenschaftskultur von Dorpat bis Straßburg, von Königsberg bis München – das ist etwas, was unter den Schlägen der Weltkriegsepoche kaputtgegangen ist. Die Verbindung von baltischer und mediterraner Dimension, ein wie selbstverständliches Leben in den Koordinaten einer deutsch-europäischen Kunstwelt – das sind alles die Zeichen der Stefan Zweigschen »Welt von gestern«. Sie ist dahin. Die Wahrnehmung an der Peripherie ist besonders empfindlich – in beide Richtungen: in die Richtung einer Erregtheit, die leicht in Hysterie und Ressentiment umschlagen kann – das zeigt gerade die Geschichte der sog. Grenzlanduniversitäten oder die historische Rolle der baltischen community in Hitlers München – , aber auch in die Richtung einer gesteigerten Empfindsamkeit für die Differenz, für die Nuancen. Ich glaube, dass es an der »Peripherie Europas« eine baltische Wahrnehmung für das Reich und für das »Spektrum Europas« gegeben hat – so hat es Graf Hermann Keyserling in seinem wichtigen Buch genannt – mit ganz eigenen Erkenntnisleistungen. Georg Dehio, um das hier abzuschließen, steht in meinen Augen für eine verlorene Dimension deutscher Selbstwahrnehmung, für eine Spannweite von Erfahrungen und Wahrnehmungen, die man sich in einem Schrumpf- und Rumpfdeutschland nach 1945 oder in einem halbseitig reduzierten Westdeutschland nur noch schlecht vorstellen konnte. In den bundesrepublikanischen Diskursen war die Evokation der baltischen Welt, der Welt des Deutschen Ostens, lange Zeit etwas von Anfang an Reaktionäres, Nostalgisches, Vergebliches, Revisionistisches. Man schämte sich gleichsam des Deutschen Ostens, so als wäre er für die Jahrhundertverbrechen der Deutschen an Juden und Slaven verantwortlich.
Dabei ist Dehio, dessen Ansichten mir in vielem fremd sind, in vielem ein guter Sprachfinder. Dehio, der Autor der Geschichte der deutschen Kunst, ist ein nobler, auch in den Zeiten der ideologischen Erhitzung gelassen bleibender Gelehrter und Autor, cool nach beiden Seiten. Zwar hatte er zusammen mit rund 3.000 Hochschullehrern am 16.Oktober 1914 die Erklärung unterschrieben, in der sich das akademische Deutschland Seite an Seite mit den kaiserlichen Armeen als Retter der europäischen Zivilisation aufspielte, doch stammen von ihm auch die Worte: »Aus der allgemeinen Kunstgeschichte diejenige eines einzelnen Volkes herauszuheben, ist ein Unternehmen, das sich aus dem Wesen der Kunst nicht begründen läßt«. Oder: »Hier ist vor nichts dringender zu warnen als vor einer falschen Auffassung des Originalitätsbegriffs. Auf sie stützen sich gleichmäßig zwei engegengesetzte Verirrungen: die Trugbilder der Deutschtümelei von einer urdeutschen Kunst und die sinnlosen Verlästerungen durch unsere Feinde, welche die Geschichte der deutschen Kunst als ein einziges Plagiat denunzieren« (zit. Gebhardt 19). Dehio hatte in der Einleitung zur Geschichte der deutschen Kunst geschrieben. »Deutsche Kunst verstehen heißt: uns selbst verstehen, unsere angeborenen Anlagen und was das Schicksal aus ihnen gemacht hat, unser Selbstgeschaffenes und unser Erworbenes, unser Erreichtes und unser Versäumtes, unser Glück und unsere Verluste – alles in allem: die Kunst als etwas mit der Ganzheit des geschichtlichen Lebensprozesses unseres Volkes unlöslich Verbundenes«. Das war geschrieben 1919, im Augenblich der Ausweisung aus Frankreich. Man hatte am Vorabend noch Albert Schweizer im Münster Bach spielen gehört und war dann über die Rheinbrücke gegangen. An derselben Stelle heißt es auch: »Heute noch darf ich diese letzten Zeilen des Buches an dem Ort schreiben, an dem es – nicht zufällig – entstanden ist, im Angesicht des Münsterbaues, dessen Steine in Ewigkeit deutsch reden werden, auch dann noch, wenn bei den Menschen um ihn her der letzte deutsche Laut verklungen sein wird, abgeschworen und vergessen« (Vorwort VI).
Über die »Steine, die deutsch reden« ist nach 1945 und auch in der letzten Zeit wieder verstärkt gesprochen worden. Wenn auch nicht im Zusammenhang des »verlorenen Westens«, sondern des »verlorenen Ostens«. Für meinen Geschmack meist mit Zurückhaltung, mit viel Takt, und in der Angst, man könnte jemanden verletzen, aber auch mit viel Überanstrengung und Krampf. Es ist ja selbstverständlich, dass die Nation und das Nationale und die nationale Kultur, allesamt Ergebnisse des 19. Jahrhunderts, nicht ins Mittelalter zurückprojiziert werden können. Aber daraus ergibt sich doch nicht, dass es nicht eine Kunst und Kultur in einem bestimmten sprachlichen, kulturellen, gesellschaftlichen und eben auch ethnischen Kontext gegeben hat. Die Beziehungen der deutschen Kultur zum östlichen Europa sind älter als die zwölf Jahre Hitler, in denen sie zugrundegerichtet worden sind. Es ist längst an der Zeit, sich dieses ungeheuren Reichtums erneut zu versichern. Es wäre ein großer Vorteil, wenn die Diskussion über das Deutsche in der Kunst und Kultur etwas entpannter und gelassener geführt würde, und wenn man ohne unter Verdacht gestellt zu werden, sagen könnte, was der Fall war: dass bestimmte Kulturdenkmäler, Städte, Anlagen, Sammlungen, Orte – für Jahrhunderte Orte eben der deutschen Kultur gewesen sind. Man bekämpft die alte Deutschtümelei nicht mit der Flucht in eine Abstraktion – heiße sie nun: Gesellschaft, Europa oder Abendland. Warum soll es nicht einen deutschen Barock im Unterschied zum italienischen oder polnischen gegeben haben! Warum soll es nicht eine polnische oder rumänische Ausprägung des internationalen Stils und des Bauhauses gegeben haben! Das sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, und dass darum immer noch Verrenkungen aufgeführt, darin Einfallstore für Revisionismus vermutet werden, ist ein Zeichen, dass wir immer noch nicht in einer Zone der Gelassenheit angekommen sind.
Wenn ich auf meine Arbeit zurückblicke, nicht ex post einen roten Faden konstruierend, dann ist es die Suche nach einer Sprache, in der sich das verlorene Europa wiedergewinnen lässt – jenseits aller Reconquista. Wie ist eine zweite Aneignung jenseits alles Revisionismus möglich? Wie läßt sich die große Geschichte dessen, was der Deutsche Osten war, auf eine nicht-revisionistische Weise neu erzählen? Wie muss der Ton beschaffen sein, in dem sich die Geschichte cum ira et studio, voller Aufmerksamkeit und Emphatie erzählen und aushalten lässt, Geschichten jenseits von Aufrechnung und Abrechnung, Geschichten, die auf den ungeheuren menschlichen und kulturellen Reichtum des alten Europa verweisen ohne den vorangegangenen Generationen jene Möglichkeiten vorzurechnen und vorzuhalten, die doch nur die Möglichkeiten der glücklich Nachgeborenen sind! Es geht hier mehr um das Finden des Tons, der die Musik macht, als um ehrenwerte Prinzipien, die sich leicht verkünden lassen; es geht hier mehr um die Aufnahme von Erfahrungen, die die eine Generation hatte, und von der die andere ausgeschlossen war; es geht um Verstehen und weniger um Richten und Tribunalisieren. Dies ist nicht gleichbedeutend mit Indifferenz und Verwischen der Differenz von Opfern und Tätern. Es muss möglich sein, dass zwei ganz verschiedene Geschichten nebeneinander bestehen und stehengelassen werden können.
Dehio ist vor der Katastrophe gestorben, eines friedlichen Todes in Tübingen, was in einem Zeitalter, in dem der gewaltsame Tod der übliche geworden ist, durchaus erwähnenswert ist. Er hat die Zerstörung der deutschen Kultur – 1933 und 1945 – nicht mehr miterlebt. Er konnte sie sich nicht einmal vorstellen.
Dehio hat, das lernen wir aus seiner Biographie, zeitlebens um den Verlust seines Augenlichtes fürchten müssen. Dies hätte bedeutet, dass er auf seine Kunstreisen hätte verzichten müssen, dass er die Arbeit an der Geschichte der deutschen Kunst, die ganz auf Inventarisierung durch Autopsie und unmittelbare Anschauung angewiesen war, nie hätte schreiben können. Dehio war ein Augenarbeiter par excellence. Wann immer es ihm möglich war – und er nutzte jeden Augenblick, oft kam er direkt aus dem Zug aus Italien in den Hörsaal zurück – riss er aus, ließ die Universität hinter sich, trat hinaus ins Reich der Eindrücke: die Landschaft der Kathedralen von Amiens und Tour, von Soest und Köln, der Schlösser und Kirchen von Würzburg und Vierzehnheiligen, die Bauten von Ravenna und Toledo. Das war Aneignung Europas, die Produktion Europas im Kopf. Heute ginge es um etwas Ähnliches: um die Erkundung, um die Vermessung der europäischen Kunst- und Kulturlandschaft nach den katastrophischen Brüchen des 20. Jahrhunderts. Dass dieser Prozess längst eingesetzt hat, zeigt sich an Arbeiten einer neuen Kunstgeographie wie sie Thomas Dacosta Kaufmann etwa vorgelegt hat. Heute kommt es, wenn wir Europa begreifen wollen, wiederum auf diese Erkundung und Neuvermessung der europäischen Kunst- und Kulturlandschaft an, und der ideale Ort, an dem diese »Landschaft, schwer gebügelt«, wie es bei Adam Zagajewski heißt, erschlossen und neu zusammengesetzt werden könnte, wäre eine Institution, wie es die Viadrina ist oder sein könnte. Das ist fast ein Generationenprogramm. Ob es gelingt, hängt nicht zuletzt daran, ob sich Exploratoren vom Schlage Georg Dehios finden.
© Karl Schlögel, Berlin im November 2004