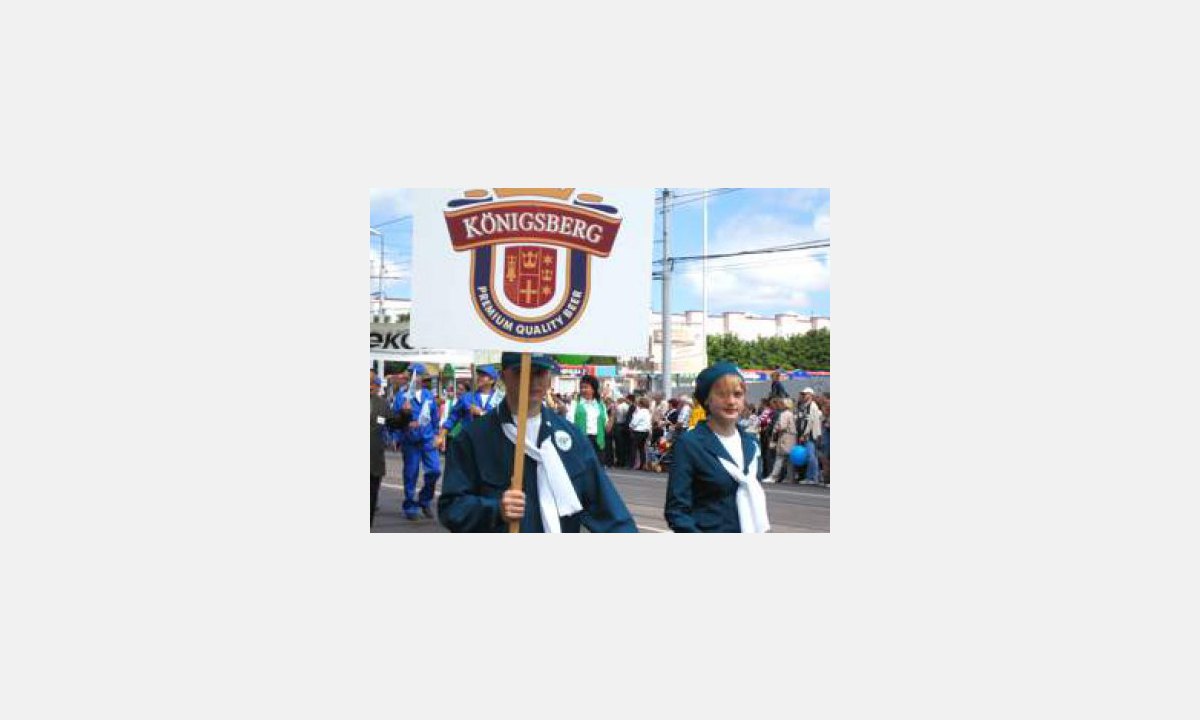Potsdamer Neueste Nachrichten • 21.12.2005
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Potsdamer Neuesten Nachrichten.
Wladimir Gilmanow wurde 1955 in einem ehemals deutschen Haus in Kaliningrad geboren. Wenn er heute an seine Kindheit zurückdenkt, fällt ihm der Kachelofen in dem Haus ein. Irgendwann habe er sich gefragt, wer sich eigentlich früher an dem Ofen den Rücken gewärmt hat. Heute ist Gilmanow Professor für Kulturgeschichte an der Kaliningrader Universität, die vor kurzem in Kant-Universität umbenannt wurde. Die Umbenennung ist für Gilmanow ein gutes Zeichen. »Ein Zeichen für ein hoffnungsvollen Weg der Region in die Zukunft«, sagt er.
In Kaliningrad findet sich in ein Denkmal zu Ehren des Barons von Münchhausen, auf dem man je nach Blickwinkel »Königsgrad« oder »Kalininberg« lesen kann. Besser kann man den merkwürdigen Schwebezustand der Stadt in der russischen Enklave zwischen Polen und Litauen kaum beschreiben. In diesem Jahr wurde das ehemalige Königsberg 750 Jahre alt. Die Moskauer Zentralregierung entschied sich, das Jubiläum unter dem Titel »750 Jahre Kaliningrad« zu begehen. »Eine hilflose Verlängerung der Gegenwart in die Vergangenheit, ein lächerlicher Versuch der Geschichtspolitik«, lautet der Kommentar des Direktors des Potsdamer Zentrums für Zeithistorische Forschung (ZZF), Prof. Martin Sabrow. Moskau scheint es bis heute schwer zu fallen, anzuerkennen, dass die Stadt, bevor sie vor rund 60 Jahren im Zuge des Zweiten Weltkriegs besetzt wurde, eine jahrhundertelange deutsche Geschichte hatte.
Zusammen mit dem Kulturforum östliches Europa hat das ZZF in diesem Jahr ein Projekt angestoßen, das die Feierlichkeiten des Jubiläums und seine Widerspiegelung in der Presse betrachtete. Ein wichtiges Kapitel darin fragt nach den Perspektiven der russischen Enklave, die seit 2004 von EU-Staaten umschlossen ist. Nach wie vor ist die Zukunft der Region vollkommen offen. Immerhin kommt die Historikerin Corinna Jentzsch zu dem Schluss, dass trotz aller Blockaden Moskaus allein durch die Entscheidung, das Jubiläum überhaupt zu begehen, der Stadt Kaliningrad eine nichtrussische Vergangenheit zugestanden worden sei. »Mit dem Stadtjubiläum wurde Kaliningrad nicht mehr ausschließlich als Siegestrophäe des Zweiten Weltkrieges gehuldigt«, so Corinna Jentzsch. Vor allem die Darstellung des frisch sanierten Königstors im Logo des Jubiläums habe einen historischen Bezug hergestellt, der keine Verbindung mit Russland aufweist. Allerdings stellt ein Mitarbeiter des Kaliningrader Gebietsarchivs auch fest, dass mit dem Jubiläum keine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt einhergegangen sei.
Die deutsche Vergangenheit Königsbergs wie überhaupt die Enklave Kaliningrad ist für Russland ein heikles Feld. Als die CDU-CSU-Bundestagsfraktion 2003 eine litauisch-russisch-polnische Euroregion mit dem historischen Namen »Prussia« vorschlug, zeigte sich Moskau entsetzt. Man vermutete revanchistische Bestrebungen. Moskaus Verhalten gegenüber dem Kaliningrader Gebiet bleibt wenig eindeutig. Hartnäckig hatte sich in der Zeit nach 1990 auch das Gerücht gehalten, Russland wolle die Enklave an Deutschland verkaufen. Die Nicht-Einladung des polnischen und litauischen Präsidenten zu den 750-Jahres-Feierlichkeiten – Schröder und Chirac waren kurz zur Vorbereitung des G8-Gipfels angereist – wiederum spricht vor allem von der Angst des Kontrollverlustes gegenüber den neuen EU-Nachbarn. Wie man auch hinschaut, es ergibt sich kein eindeutiges Bild. Eigentlich weiß keiner so genau, was Moskau mit Kaliningrad vorhat.
Einen recht pessimistischen Blick auf die Region eröffnete dann auch auf einer Podiumsdiskussion des Kulturforums Heike Dörrenbächer von der Deutschen Gesellschaft für Europakunde. Bis heute fehle es für die Stadt mit über 400.000 Einwohnern an Infrastruktur, der Bekämpfung der Korruption, den entsprechenden Gesetzen und vor allem auch am politischen Willen für eine wirtschaftliche wie territoriale Öffnungspolitik. »Die Angst in Moskau ist zu groß, dass das Gebiet eine eigene Entwicklung nehmen könnte.«
Doch wenn man den Landstrich mit seinen fast eine Million Bewohnern heute betrachtet, wird deutlich, wie überfällig eine solche Entwicklung ist. Wladimir Gilmanow hat für die jüngere Vergangenheit nur ein Wort: tragisch. Die nach der Vertreibung und Flucht der Deutschen gezwungenermaßen angesiedelten Russen hätten in den ersten Jahrzehnten keine Bezüge zu dem Land gehabt. Es hätte an der nötigen Liebe zur Heimat gefehlt. »Alles hat zu lang gedauert, zu viel ist kaputt gegangen.« Die Probleme mit der Identität würden bis heute nachwirken, die Selbstmordrate sei 25 Prozent höher als im übrigen Russland. »Die Menschen in dieser Region sind verwaist, instrumentalisiert und verloren«, sagt der Kulturwissenschaftler in einem eindringlichen Appell während der Diskussion. Heute, nach Jahrzehnten eines gescheiterten Experiments, müsse man Verständnis zeigen für dieses Volk. »Das Land ist liebenswert, aber krank«, so Gilmanow. Für die Zukunft benötige man dringend ein Vorbild. Heike Dörrenbächer schlägt vor, Literatur aus Ostpreußen ins Russische zu übersetzen, um ein Bewusstsein für die Geschichte des Landstrichs zu schaffen. Eine Aufgabe, der sich das Potsdamer Kulturforum ohnehin schon seit Jahren widmet.
So düster das Bild auch ist, Gilmanow sieht auch eine Zukunft. Und die hat auch etwas mit der verloren gegangenen deutschen Vergangenheit zu tun, mit dem untergegangenen Königsberg. Mit dem Atlantis oder Vineta Ostpreußens, wie Fernsehmoderator Dirk Sager formuliert. »Das russische Gewissen habe längst erkannt, dass die Stadt auch etwas mit Deutschen und Vertriebenen zu tun hat«, sagt Wladimir Gilmanow. Er träumt von einer Hochschule mit Polnisch, Litauisch und Deutsch neben Russisch als Pflichtsprachen »Wir müssen uns finden«, sagt er. Kein anderer Weg führe in die Zukunft.
Die Kaliningrader sind wohl schon viel näher an diesem Weg als die Moskauer Zentralverwaltung es wahrhaben will. »Im Kaliningrader Gebiet setzen sich die Bewohner bereits seit den achtziger und neunziger Jahren mit der regionalen Geschichte auseinander«, so Historikerin Jentzsch. »Das deutsche Königsberg ist Teil der gelebten Alltagskultur geworden.« Gegenstände aus der deutschen Zeit würden gesammelt, die Einwohner würden auf die für eine russische Stadt ungewöhnliche Architektur mit Stolz verweisen. Schulkinder zeichnen hier die Häuser meist mit Spitzdach, während sie in Russland Flachdächer malen. »Vor allem die jüngere Generation interessiert sich für die Vergangenheit der Stadt und nennt sie ›Kenig‹.«
Durch die Jubiläumsfeiern hat Kaliningrad gewonnen, die Hauptstraßen sind frisch asphaltiert, die Fassaden gestrichen, Denkmäler saniert und der Bauboom hälte an. Peter Wunsch, der in der Stadt das Deutsch-Russische Haus leitet, blickt optimistisch nach vorne. Heute herrsche die Ruhe vor dem Sturm, die Vorbereitungszeit auf eine neue, wichtige Rolle der Stadt als Drehscheibe zwischen Ost und West, zwischen gestern und heute. Schon heute würden sich die Kaliningrader als Russen und Europäer fühlen. Und eine Lösung für die Namenswirren der Stadt hat er auch: Seine Tochter sei vor zwei Jahren im Königsberger Dom getauft worden, geboren wurde sie in Kaliningrad. So einfach ist das.
- Königsgrad und Kalininberg
Der Originalartikel in der Online-Ausgabe der Potsdamer Neuesten Nachrichten
- 750 Jahre Königsberg – 60 Jahre Kaliningrad: Ein Jubiläum mit Perspektive?
Podiumsdiskussion im Rahmen der Reihe Potsdamer Forum