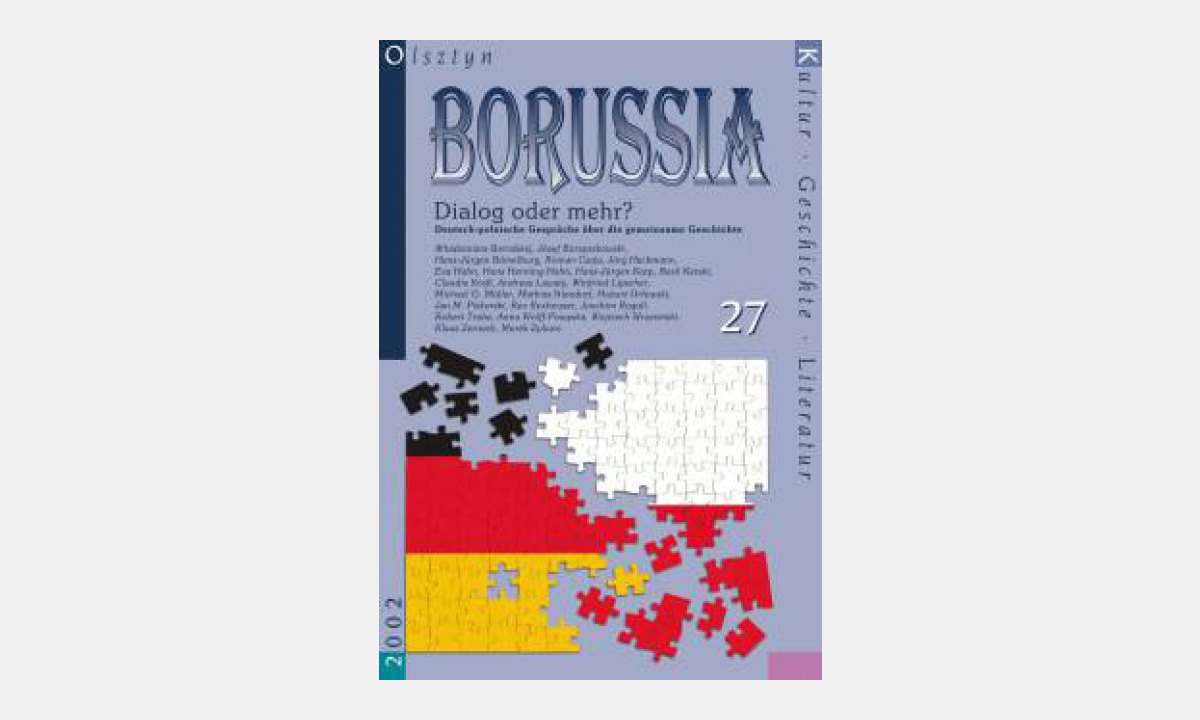Geschichte sei
»die geistige Form, in der eine Kultur Rechenschaft über ihre Vergangenheit ablegt«
lautet die bekannte Äußerung von Johan Huizinga. Geschichtsschreibung dient also der Selbstvergewisserung, sie stiftet Identität, und sie ist stets mit der Gegenwart verbunden. Umbrüche in der Gegenwart gehen so auch mit einem Umbruch in der Geschichtsbetrachtung einher. Revolutionen in der Gegenwart werfen so die Frage nach Revolutionen in der Geschichtswissenschaft wie in den Gesellschaftswissenschaften allgemein auf. Ebenso wie die Politologen oder Soziologen müssen sich auch die Historiker an den Anforderungen messen lassen, die die Gegenwart an sie stellt. Die deutsche Osteuropawissenschaft erfuhr dies in den neunziger Jahren schmerzhaft, als ihr vorgehalten wurde, für den Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums nicht gewappnet gewesen zu sein. Der Umbruch von 1989 / 1991 in Mittel- und Osteuropa stellt daher auch einen Wendepunkt für die Historiker dar, und sie müssen sich die kritische Frage gefallen lassen, ob ihre Werke auf die Fragen, die heute an sie gestellt werden, antworten können. Sich dieser Anforderung mit dem Hinweis auf den Objektivitätsanspruch des Geschichtswissenschaftlers zu entziehen, wäre ein Rückfall über ein Jahrhundert zurück in die Zeit vor Johann Gustav Droysen.
Wenn wir die Frage auf die Region des früheren Ostpreußen beziehen, dann muss sie also lauten: Können die Historiker auf die Fragen antworten, die heute an die Geschichte der Region gestellt werden? Das betrifft zunächst einmal die »beteiligten« Nationen: Deutsche, Polen, Litauer und Russen. Aber da Geschichtswissenschaft längst keine nationale oder ethnozentrische Angelegenheit mehr ist, sondern sich als international und universal versteht, ist der Sachverhalt inzwischen komplizierter geworden, denn längst bedienen die Historiker nicht mehr nur die Leserschaft ihrer Nation, oder umgekehrt: die Leser historischer Werke orientieren sich nicht mehr allein an nationalgeschichtlichen Kategorien. So interessiert man sich in Deutschland für die Arbeiten polnischer und litauischer Historiker, so wie deutsche Veröffentlichungen intensiv in Polen, Litauen und Kaliningrad rezipiert werden.
Blicken wir auf die Region des früheren Ostpreußen, so hat sich im vergangenen Jahrzehnt ein Wandel vollzogen, den zuvor wohl nur wenige für möglich gehalten hatten. Die territorialen und mentalen Grenzen, die in den achtziger Jahren noch unüberwindbar schienen, sind zwar nicht verschwunden, sie haben aber ihre Absolutheit verloren. Das gilt für die einst hermetische Grenze zwischen Polen und der Kaliningradskaja Oblast‘, und es gilt auch für die Grenze zwischen Litauen und der Oblast‘. Das mag paradox klingen, ist diese Grenze für die Einwohner der vergangenen Sowjetunion doch erst nach 1991 entstanden; für alle Ausländer freilich war das Gebiet Kaliningrad zuvor unzugänglich (und Sperrzonen wie Baltijsk / Pillau konnten erst wesentlich später betreten werden). Verglichen mit den Verboten aus sowjetischen Zeiten hat heute die Grenzabfertigung auf der Kurischen Nehrung und in Sovetsk / Tilsit ein beachtliches Maß Normalität, ungeachtet der Tatsache, dass es noch ein großes Potential für Erleichterungen gibt.
Mindestens ebenso wichtig wie das Überqueren der Staatsgrenzen sind die mentalen Grenzüberschreitungen, die sich aus verschiedenen Quellen speisen. Die wichtigste ist sicherlich das Bedürfnis der Bewohner der Region, ein plausibles und glaubwürdiges Bild der Vergangenheit zu erhalten, um sich eine Lebenswelt zu schaffen, die die ihre ist. Dafür ist die Orientierung in der Region eine fundamentale Voraussetzung. So entsteht das Bedürfnis, die Umwelt, auch wenn sie zunächst »fremd« ist, als »eigene« aufzufassen. Gerade die materiellen Relikte früherer Generationen, seien es Fotos, Häuser, Kirchen oder Friedhöfe, fordern diese interpretatorische Anstrengung heraus und stellen die ideologischen Deutungsmuster, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts produziert wurden, infrage. Diese Tatsache ist von nicht geringer Relevanz, zeigt sich doch seit einigen Jahren, dass gerade die Aneignung »fremder« geschichtlicher Traditionen eine erhebliche Bedeutung für die kulturelle Entwicklung der Region hat und sich keineswegs nur auf das Fachinteresse derjenigen beschränkt, die sich als Museumsfachleute, Denkmalpfleger oder Geschichtslehrer von Beruf wegen mit der Geschichte befassen. In der Architektur und Denkmalpflege lässt sich exemplarisch die Wirkungskraft historischer Topographien erkennen, die eine neue Aneignung geradezu erzwingen. Dieser Prozess hat in Polen und Litauen bereits eine jahrzehntelange Tradition, aber er hat sich in den letzten Jahren zweifellos verstärkt und ist öffentlich geworden. Und er wird (erst) jetzt von denjenigen wahrgenommen, die sich in Deutschland als die Bewahrer des regionalen Erbes ausgeben. Dass sich hier zahlreiche Anknüpfungspunkte für eine internationale Zusammenarbeit anbieten, liegt auf der Hand.
Blicken wir auf die Historiographie zu Ostpreußen, so hatten wir es lange Zeit mit einem verminten Terrain zu tun. Sie war seit langer Zeit mehr oder weniger ideologisch befrachtet. Eine Geschichtsschreibung, die diese Einwirkungen ignorierte, war jahrzehntelang kaum vorstellbar. Begriffe und Argumentationen waren in Codes eingebunden, bei denen ein Wort oder ein Satz reichte, um ganze Ketten von Assoziationen auszulösen. Das fing bei den Ortsnamen an. Wer als (West-)Deutscher »Allenstein« statt »Olsztyn« sagte, wurde von den Verteidigern der volkspolnischen Staatsraison sofort als Revanchist entlarvt, und umgekehrt: wer in der alten Bundesrepublik von »Olsztyn« sprach, der wurde verdächtigt, sowjetisch infiltriert zu sein und die Wiedervereinigung Deutschlands infrage zu stellen. Zweifelsohne waren die meisten russischen und auch einige polnische Umbenennungen von Orten nach 1945 ideologisch motiviert, aber ideologischen Erwägungen entsprang ebenfalls (west-)deutscherseits das Festhalten an den alten deutschen Namen, von denen viele im polnisch-litauischen Grenzgebiet ebenso künstlich waren, beruhten sie doch auf Umbenennungen aus der Zwischenkriegszeit, die ihren polnischen oder litauischen Ursprung verbergen sollten. Diese Streitpunkte setzten sich in der Benennung der Region fort: In der Bundesrepublik blieb man – selbstverständlich wie es schien – bei »Ostpreußen«, in Polen dominierte »Ermland und Masuren« als Name, in Kaliningrad war es die »Kaliningradskaja Oblast‘« und in Litauen »Kleinlitauen«, ein Namen, den Deutsche und Polen zum größten Teil in den neunziger Jahren zum ersten Mal hörten. Und man kann hinzufügen, in allen Fällen beharrte man auf der exklusiven Richtigkeit des eigenen Standpunktes. Alle Perspektiven waren daher so eng begrenzt wie der Blick durch ein Fernrohr, und zwar in mehrfacher Hinsicht: die polnische, russische und litauische – territorial, denn man orientierte sich an der politischen Zugehörigkeit der Region. Die deutsche und russische Perspektive – zeitlich, denn deutscherseits blickte man nicht über 1945 hinaus, russischerseits fing die Geschichte nicht vor 1945 an. Dazu kamen thematische Begrenzungen: in Deutschland erblickte man in erster Linie die preußische Verwaltung, deren Anfänge der Bonner Historiker Walther Hubatsch schon im Ordensstaat sah, in Polen und Litauen ging es um die jeweilige Nationalgeschichte, und russischerseits dominierte der »Штурм Кенигсберга« den Blick. Nun könnte man einwenden, in Deutschland habe man auch die polnische und litauische Bevölkerung berücksichtigt, die Perspektive sei also nicht national begrenzt gewesen. Die Wahrnehmung als »Schicksalsgemeinschaft« mit dominanter deutscher Kultur freilich war wenig geeignet, eine Basis für die Darstellung der interethnischen Beziehungen abzugeben, und so scheiterte dieses Deutungsmuster zwangsläufig an der Thematisierung der modernen Nationalismen in Ostpreußen.
Diese skizzenhaften Linien sollen den Hintergrund für die Frage abgeben, was sich im letzten Jahrzehnt in der Geschichtsschreibung verändert hat. Gibt es Ansätze, die das Überschreiten und Aufweichen der alten Grenzen erkennen lassen? Der Beurteilungsmaßstab, an dem ich mich orientiere, leitet sich aus den eben gemachten Bemerkungen ab. Erstens geht es um die Frage, ob und wie die fragmentarisierten Bildausschnitte sich zu einem komplexeren, zu einem ganzheitlichen Bild fügen. Das wichtigste Thema scheint mir zweitens zu sein, wie die polykulturelle, polyethnische, oder mit anderen Worten ostmitteleuropäische Struktur der Region in synchroner wie diachronischer Hinsicht dargestellt wird. Hier soll es nun nicht um einen Forschungsbericht gehen, sondern um einen Überblick über die Frage, welches Bild sich dem an der Region und ihrer Geschichte Interessierten darbietet.
Beginnen wir den Durchgang mit der deutschen historiographischen Produktion: An erster Stelle ist hier zweifellos Hartmut Boockmanns Buch »Ostpreußen und Westpreußen« zu nennen, das als erster Band der groß angelegten Reihe »Deutsche Geschichte im Osten Europas« erschien (Berlin, 1. Aufl. 1992, mittlerweile liegt die 3. Auflage vor). Obwohl Boockmann eine ausführliche historiographiegeschichtliche Einleitung (S. 11–74) voranstellt und sich deutlich von nationalistischen Perspektiven früherer Historiker abgrenzt, bleibt sein Text in seiner Komposition doch einer traditionellen deutschen Perspektive verhaftet. Nach knappen Bemerkungen zu den Pruzzen, die in das Kapitel über die Eroberung des Landes durch den Deutschen Orden eingeflochten sind (S. 75–115, hier 78, 81 f., 85), folgt eine ausführliche Darstellung des Ordensstaates (S. 116–221). Knapp gehalten ist vor allem der Abschnitt zum Königlichen Preußen, (255–295) etwas ausführlicher geht er auf das Herzogliche Preußen und das Königreich ab 1701 ein (S. 222–254, 296–332). Für das 19. und 20. Jahrhundert nimmt die Darstellung der Reformära und der Regierungszeit des Oberpräsidenten von Schön ein Drittel des Platzes ein (S. 333–366), entsprechend knapp werden dagegen die Jahre von 1848 bis 1945 behandelt (S. 367–424), wobei (das polnische) Pommerellen nach 1918 nicht vorkommt. Boockmann beschließt sein Buch mit einem Kapitel »Das Ende Ost- und Westpreußens« (S. 425–439), in dem er auf die Vertriebenen in Westdeutschland eingeht. Zum Teil ergeben sich die Gewichtungen aus der Gesamtkonzeption der Siedlerschen Reihe, die – pointiert gesagt – keine Regionalgeschichte der interethnischen Beziehungen bieten will, sondern deutsche Geschichte in Osteuropa. Aber dennoch wäre auch mit dieser Einschränkung ein umfassenderer Ansatz möglich gewesen. Denn in der Einleitung schreibt Boockmann, dass die Geschichte Ostdeutschlands heute eine Sache derer sei, die westlich von Oder und Neiße leben (S. 19 f.). Auf den Wandel im Geschichtsbewußtsein der heutigen Einwohner der Region, die zahlreiche Anknüpfungspunkte aus der Geschichte vor 1945 gewinnen, ist er in dem Buch nicht eingegangen. Das freilich ist mit Blick auf die Entstehungszeit des Buches verständlich, im Gespräch hat Hartmut Boockmann diese Veränderungen mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, und er hat auch gesehen, dass sich in der deutschen Haltung zu den ehemals deutschen Ostgebieten Veränderungen anbahnen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die interethnischen Beziehungen bei Boockmann längst nicht in dem Maß zur Geltung kommen, wie wir sie heute behandelt sehen möchten.
Vor dem Hintergrund von Boockmanns Werk muss dann allerdings der Eindruck um so negativer ausfallen, den das von Ernst Opgenoorth herausgegebene »Handbuch zur Geschichte Ost- und Westpreußens« vermittelt (bislang sind vier Bände für den Zeitraum von 1466 bis1945 erschienen, Lüneburg 1994–1998). Das liegt nicht an der Gliederung der Darstellung, die strukturgeschichtlichen Themen viel Platz einräumt, sondern an der dilettantischen Bearbeitung einzelner Abschnitte – insbesondere für das 20. Jahrhundert – und an der Tatsache, dass der Herausgeber davon überzeugt war, sprachliche Kompetenz (vor allem für die Rezeption der polnischen Forschung) sei für die Abfassung des Handbuchs nicht erforderlich. Auch drängt sich der Eindruck auf, dass hier ein nationalgeschichtliches Modell zugrundeliegt, dass nach einer deutschen und einer polnischen Sicht der Dinge zu trennen versucht. Wenn der Herausgeber außerdem seine biographische Verbundenheit zu Ostpreußen darlegt, so wird deutlich, dass das Handbuch eher ein Dokument für die landsmannschaftliche Perspektive einer Historikergeneration ist, die ihre Arbeit mit der kulturellen Förderung der Vertriebenenverbände in der alten Bundesrepublik verbunden hat. Dennoch sind in diesem Handbuch auch Passagen zu finden, die sich mit der multiethnischen Struktur befassen. Selbst wenn wir aber die Frage außer acht lassen, ob sie angemessen berücksichtigt sind, bleibt noch ein weiterer Einwand. Denn ihre Betrachtung ist nach wie vor geprägt von einer These Erich Maschkes, die der »deutschen Ostforschung« der dreißiger Jahre entspringt. Maschke sah die Bildung des deutschen Neustamms der Preußen in der Region 1466 abgeschlossen, also zum Zeitpunkt der Teilung des Landes in den königlich-polnischen und den herzoglich-hohenzollernschen Teil. Mit dieser volksgeschichtlichen These (die sich in der Zwischenkriegszeit zu der Behauptung von deutschem Volkstum trotz polnischer Herrschaft verstieg) verband sich auch nach 1945 die deutsche Perspektive, dass die geschichtliche Entwicklung Ostpreußens letztlich auf eine Germanisierung seiner Bevölkerung hinausgelaufen sei. Statt Assimilations- und Dissimilationsprozesse unvoreingenommen zu betrachten, wird immer noch die Germanisierung als natürlicher Endpunkt der Landesgeschichte betrachtet, wäre es nicht zu negativen Einwirkungen von außen gekommen. So drängt sich der Eindruck auf, dass manche der Verfasser sich nicht aus den Schützengräben des nationalen Konfliktes und volksgeschichtlicher Argumentationslinien haben lösen können. Die Herausgeber des Handbuchs haben die Chance verpasst, auf die zeitgenössischen Fragen mit dem Instrumentarium der modernen Geschichtswissenschaft zu antworten; sie haben es auch nicht geschafft, ein Werk vorzulegen, daß in der internationalen Diskussion bestehen wird. Das soll nicht ausschließen – wie bereits ausgeführt –, dass einzelne Abschnitte gelungen sind. Aber der Gesamteindruck wie die einleitenden Bemerkungen der Herausgeber lassen nur den Schluss zu, daß dieses Handbuch aus einem sehr beschränkten Blickfeld heraus und mit einer streckenweise erstaunlichen Naivität produziert wurde. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit der Neuauflage des Ost- und Westpreußen-Bandes des Dehio-Handbuchs der Kunstdenkmäler (Deutscher Kunstverlag 1993, bearbeitet von Michael Antoni), hier haben mehrere Rezensenten ebenfalls zahlreiche Versäumnisse festgestellt, die den Band hinter die erste Auflage von Ernst Gall zurückfallen lassen.
Wenn wir nun nach weiteren deutschen Büchern und Aufsätzen Ausschau halten, so ergibt sich dennoch ein Bild, das einiges zur Aufhellung beiträgt. Zu nennen wären hier – exemplarisch und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – Themenhefte des Lüneburger »Nordost-Archivs«, die sich mit der Universität Königsberg, Schulen in ethnischen Mischgebieten und kollektiven Identitäten in Pommerellen befaßt. Ansätze für die Betrachtung der interethnischen Beziehungen enthält auch das Heft 1997 des von der Ostsee-Akademie herausgegebenen »Mare Balticum«. Es ließen sich weitere Arbeiten anführen, wie etwa das gemeinsame Bielefelder und Warschauer Forschungsprojekt zu Ethnizität und symbolischer Aneignung in Masuren, das sich insbesondere mit den Aneignungsprozessen nach 1945 befasst. Auch gibt es neue Ansätze zur Geschichte der Masuren und Litauer in Ostpreußen wie zur jüdischen Geschichte und zu den Nationalismen des 19. Jahrhunderts, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Nehmen wir die polnischen Publikationen in den Blick, so müssten wir zweifellos eine größere Produktion betrachten, aber ich beschränke mich auf ein paar knappe Bemerkungen. Beginnen wir auch hier mit den Synthesen. Die wichtigste ist zweifellos die »Historia Pomorza«, die sich auch mit Ostpreußen befasst. 1993 und 1996 erschienen die ersten beiden Teilbände des dritten Bandes, der sich mit dem Zeitraum von 1815–1850 befasst. Da die »Historia Pomorza« den größeren Zusammenhang der preußischen Küstenregionen von Rügen bis Memel umfasst, behandelt sie im ersten Teil umfassendere Fragen der politischen und wirtschaftlichen Verfassung; der zweite Teil befasst sich dann ausführlich mit nationalen und konfessionellen Fragen, vor allem in Ost- und Westpreußen. In seinem Vorwort unterstreicht Gerard Labuda die Intention, den Beitrag aller Nationalitäten in »Pomorze« (einschließlich Litauern, Kaschuben, holländischen Mennoniten und Juden) an der Landesgeschichte herauszustellen. Der Beitrag über die Nationalitäten in Ost- und Westpreußen, so Labuda, versuche zum ersten Mal, dieses Thema vor dem Hintergrund der innenpolitischen Auseinandersetzungen in Deutschland in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu behandeln. Zweifelsohne bietet die Synthese in Qualität und Quantität unvergleichlich mehr als das oben erwähnte deutsche Handbuch; dennoch weist sie gerade dort, wo es um die nationalen Fragen der Region in diesem Zeitraum geht, auch Probleme auf. Der Ausgangspunkt jedoch, die gesellschaftliche Entwicklung unter der Fragestellung der Nationsbildung auch bei der deutschen Bevölkerung zu betrachten, ist durchaus sinnvoll. Fraglich ist aber, ob eine klare Trennung der gesellschaftspolitischen Entwicklung nach nationalen Kriterien vorgenommen werden kann. So werden hier die Konflikte zwischen Konservativen und Liberalen als »deutsche Problematik« behandelt, während dann etwa der Novemberaufstand und auch große Teile der Revolution von 1848 aus dem Blickwinkel der polnischen Nationalbewegung betrachtet werden. Damit werden die interethnischen Beziehungen mit den Kategorien des entwickelten nationalen Gegensatzes Ende des 19. Jahrhunderts betrachtet, die dann auf den Beginn des Jahrhunderts projiziert werden. Zugleich wird eine klare Trennungslinie zwischen Deutschen einerseits und den nichtdeutschen Nationalitäten andererseits gezogen. Deutlich wird das vor allem in dem Abschnitt über die Germanisierungspolitik (III, 2, 111–170). Hier bezieht die »Historia Pomorza« eine Position, die als Spiegelbild der Argumentation Maschkes betrachtet werden kann. Diese an dem Kriterium Polonität orientierte Perspektive beruht letztlich auf der These, daß die preußische Verwaltung seit 1795 eine konsequente Polonisierungspolitik betrieben habe, gegen die sich dann polnischer (und auch kaschubischer, litauischer) Widerstand geregt habe. Stellenweise finden sich auch deutliche Parteinahmen für die polnische oder litauische Seite, etwa wenn davon gesprochen wird, dass die fortschreitende Germanisierung durch die höheren Zuwachsraten der polnischen und litauischen Bevölkerung ausgeglichen wurden ( III, 1, 176). Diese Traditionalität, mit der die Probleme von Assimilierungsprozessen im 19. Jahrhundert behandelt werden, durchzieht große Teile der Darstellung. Insofern bietet sich kein Bild, das sich von früheren Arbeiten deutlich absetzt. Kaum anders verhält es sich mit der Geschichte Ermlands und Masurens von Stanisław Achremczyk (Olsztyn 1992). Für die Zeit ab den Teilungen Polens kommt dort praktisch nur noch die polnische Bevölkerung im heute polnischen Teil Ostpreußens in den Blick. Auch wenn in der Darstellung der Flucht und Vertreibung der deutschen Bevölkerung gewiss ein neuer Aspekt zu erkennen ist, so findet sich zu der Frage nach der Aneignung des historischen Erbes nur der Satz, dass die Neusiedler die schwierige Geschichte des Landes entdeckten.
Somit ist nun auch für die polnische Diskussion auf Beiträge hinzuweisen, die außerhalb von Synthesen und Handbüchern erschienen sind. Der wichtigste neue Ansatz ist zweifellos in der Zeitschrift »Borussia« zu sehen, die sich seit 1992 mit den regionalen Identitäten in Ostpreußen befasst und in Essays wie Diskussionen die polynationale Kultur und Geschichte der Region aufspürt. Exemplarisch zu nennen wäre im ersten Heft von 1992 eine offene und selbstkritische Diskussion über die traditionellen nationalen Sehweisen auf die Region, der im dritten Heft die Beiträge einer Tagung von 1991 folgen, auf der es um das historische Erbe und neue Identität in der Region ging[1], und zwar mit Beteiligung russischer, deutscher und ukrainischer Diskutanten; einzig Litauer waren damals noch nicht vertreten. Gerade in dieser Diskussion sind freilich auch die Schwierigkeiten zu erkennen, die namentlich ältere Generationen beim Verlassen der nationalen Schützengräben haben. Seit diesen Anfängen ist jedoch so viel passiert, dass es hier nicht rekapituliert werden kann. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass dieses Streben nach einem neuen offenen oder europäischen Regionalismus als Leitidee bislang bereits erstaunlich viel erreicht hat. Und dabei hat sich der Blick auf die Geschichte gewandelt, bislang vor allem in Facetten, unter Aufgabe der nationalen Grenzlinien. Dabei wäre es freilich reizvoll zu untersuchen, wie sich Grenzerfahrungen tradieren; manche Stimme der polnischen Publizistik könnte im Bericht über die östlichen Nachbarn den Vorwurf eines Kulturträgerbewusstseins auf sich ziehen. Der Befund zur Regionalisierung ließe sich auch an der Zeitschrift »Masovia« verdeutlichen, auch wenn hier nun eine engere, auf Masuren begrenzten Perspektive anzutreffen ist. Wenn sich dort in der ersten Ausgabe Arbeiten aus dem bereits genannten Bielefelder und Warschauer Forschungsprojekt finden, so zeigt das schon, dass hier die Diskussion längst nicht mehr eindeutig deutsch-polnisch zu klassifizieren ist. Wir können also festhalten, dass die polnische Diskussion längst grenzübergreifend ist und deutsche, russische, litauische Gesprächspartner einbindet.
Schließen wir ein paar knappe Bemerkungen zur russischen und litauischen Perspektive an. Für’s erste ist vor allem eine neuere Publikation zu nennen, und zwar eine Synthese zur Geschichte Ostpreußens, die 1996 in Kaliningrad erschienen ist (Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны. Исторические очерки, документы, материалы. Ред.: Г.И. Шеглова, В.И. Гальцов, В.С. Исупов и др.). Die Tatsache ist wirklich bemerkenswert, und auch wenn die Darstellung sich vor allem am nördlichen Ostpreußen orientiert und manche ältere Urteile durchscheinen lässt, so wiegt hier doch der Neuansatz weit mehr als die kritischen Einwände, und er zeigt die Bereitschaft zur Neubetrachtung der Geschichte zur Begründung regionalen Bewusstseins der russischen Einwohner der Region.
Bleibt noch Litauen. Hier möchte ich auf zwei gegenläufige Tendenzen hinweisen, zum einen lässt sich eine nachholende Nationalisierung der ostpreußischen Geschichte feststellen. Sie beginnt mit der Betrachtung der prußischen Zeit und betrachtet sie gewissermaßen als verhinderten Teil litauischer Nationalgeschichte und befasst sich dann schließlich mit der litauischen Annexion des Memelgebiets 1923 als dem Beginn litauischer Staatsgeschichte in der Region. Zu nennen wäre hier etwa das Buch von Algirdas Matulevicius über Kleinlitauen im 18. Jahrhundert (Mažoji Lietuva XVIII amžiuje. Lietuviu tautine padetis, Vilnius 1989) sowie die Veröffentlichungen der Kleinlitauischen Stiftung (Mažiosios Lietuvos Fondas). Dagegen steht andererseits eine kritische Reflexion kleinlitauischer Geschichte, die auf die Wechselwirkungen mit Deutschen und Polen Wert legt und aus einer engen litauisch nationalgeschichtlichen Perspektive ausbricht, wie etwa an dem kleinen Buch »Ringen um Identität« von Vytautas Žalys (Lüneburg 1993) zu erkennen ist. Zu nennen sind hier außerdem die Veröffentlichungen in den Acta Historica Universitatis Klaipediensis. Ein nicht zu unterschätzender Beitrag der litauischen Historiker liegt nicht zuletzt darin, dass sie den »größeren« Nachbarn die litauischen Aspekte ostpreußischer Geschichte nahebringen. Wenn die jüngere polnische Diskussion grenzübergreifend orientiert ist, so gilt das vice versa auch für die Konzeption des Forschungszentrums für westlitauische und preußische Geschichte an der Universität Klaipeda.
Diese Interaktionen ermutigen zu der Folgerung, dass wir einen gemeinsam erarbeiteten Überblick der ostpreußischen Geschichte brauchen, der gerade die interethnischen Beziehungen in den Blick nimmt. Dabei wird sich rasch zeigen, dass es dabei nicht nur um einzelne und schon gar nicht um marginale Aspekte ostpreußischer Geschichte geht, sondern dass wir es hier mit einem für die Regionalgeschichte in der Perspektive der langen Dauer relevanten Phänomen zu tun haben. Eine solche Wende in der Geschichtsschreibung zu Ostpreußen ist kein leichtes Manöver, sie braucht offensichtlich einigen Vorlauf, aber es dürfte klar sein, dass wir ohne sie zwar (vielleicht zahlreiche) gute Einzelstudien haben, für die sich die Fachleute hoffentlich interessieren, dass es dann aber am Abschluss fehlt: den Antworten der Historiker zu den Fragen nach der Identität der Region.
Erschienen auf polnisch unter dem Titel: Potrzeba zmiany. Głos za rewizją w uprawianiu historii Prus Wschodnich, in: Borussia 22, 2000, S. 64–72.
Postscriptum
Lübeck, Januar 2002
Janusz Jasiński hat mir mit seiner Replik[2] auf meinen Text vorgeworfen, ich hätte die zulässigen Grenzen des Anstandes gegenüber ihm und seinen polnischen Kollegen überschritten, und zugleich Robert Traba angegriffen, daß er den Druck meiner »Worte der Insinuation« zugelassen habe. Worum geht es? Jasiński bezieht sich auf meine Ausführungen in dem oben gedruckten Text, die der polnischen Geschichtswissenschaft, insbesondere seinen Ausführungen in der »Historia Pomorza«, gelten. Vor allem kritisiert er meinen Satz:
»Hier bezieht die »Historia Pomorza« eine Position, die als Spiegelbild der Argumentation Maschkes betrachtet werden kann.«
Daraus folgert er, ich hätte ihn und seine polnischen Kollegen mit einem nationalsozialistischen »Fälscher der polnischen Geschichte« gleichgesetzt.
Janusz Jasiński hat meinen Text offensichtlich missverstanden. Wie unschwer zu sehen ist, habe ich Erich Maschke an zwei Stellen erwähnt, und zwar zunächst im Kontext des deutschen »Handbuchs zur Geschichte Ost- und Westpreußens« und dann in dem soeben zitierten Satz. Weder hier noch dort ging es mir um eine Diffamierung durch Gleichsetzung, sondern allein um den Hinweis auf vergleichbare historiographische Denkfiguren. Daß Vergleichen nicht Gleichsetzen heißt, sei hier ausdrücklich hervorgehoben, um weiteren Fehlinterpretationen vorzubeugen. Auch das tertium comparationis sei noch einmal verdeutlicht: ich habe mich auf die Denkfigur bezogen, daß gegen den jeweiligen Herrschaftswechsel in Preußen die ethnischen Verhältnisse als historiographisches Argument aktiviert werden: durch die Neustammbildung sei Preußen auch nach 1454/1466 der deutschen Geschichte zuzurechnen, war das Argument Maschke; geht es um die polnische Geschichtsschreibung habe ich mich auf das Argument bezogen, seit 1795 fokussiere sie auf die polnische, kaschubische und litauische Bevölkerung als Objekt der preußischen Germanisierungspolitik. Dagegen ließe sich einwenden, der erste Fall lasse sich nicht mit dem zweiten vergleichen, weil die Tatsachen andere seien. Dann würden wir jedoch zu einer inhaltlichen Diskussion gelangen, die freilich nicht auf dem Niveau der eingangs zitierten Vorwürfe geführt werden kann. Es muß freilich angemerkt werden, daß ich keineswegs die Politik Theodor von Schöns ignoriert habe, wie Jasiński meint, sondern mir ging es um die Analyse des historischen Prozesses, in dem sich die polnische Nation in der Region herausbildet. Tatsächlich ließe sich an der Beurteilung Schöns zeigen, daß hier immer noch deutlich divergierende Bewertungsmaßstäbe an den Tag gelegt werden. Während Jasiński in ihm den ersten großen Germanisator sieht, hat Bernhart Jähnig auf einer Tagung in Oldenburg unlängst die Meinung vertreten, daß von einem deutsch-polnischen Nationalitätengegensatz in seinem Denken nicht die Rede sein kann. Diese offensichtliche Aporie durch einen neuen Blick auf die Entstehung des modernen Nationalismus aufzulösen, war ein Ziel meiner obigen Ausführung. Wenn diese Intention der tatsächlichen Entwicklung der Geschichtsforschung zu Ost-und Westpreußen hinterherhinken sollte, dann lasse ich mich gerne in meiner Umwissenheit belehren.
Entscheidender ist hier freilich der von Janusz Jasiński vehement vorgetragenen Vorwurf, daß ich überhaupt den Namen Erich Maschkes in Verbindung mit polnischen Hisorikern gebracht habe. Auf welche Überlegungen von Maschke habe ich mich bezogen? Es handelt sich um den zuerst 1955 erschienen Aufsatz »Preußen. Das Werden eines deutschen Stammesnamens«.[3] Dieser Text ist in der deutschen wie polnischen Geschichtswissenschaft zu Ost- und Westpreußen häufig zitiert worden, ohne daß bisher eine besondere Prägung dieses Textes durch antisemitisches oder nationalsozialistische Ideologeme kritisiert worden wäre. Im Gegenteil, Marian Biskup hat diesen Text als »scharfsinnig«[4] bezeichnet und ihn unter wissenschaftlichem Aspekt kritisiert, da er sich einseitig auf die deutsche Bevölkerung konzentriere. Bislang ist auch noch niemand auf den Gedanken verfallen, den Autoren, die sich auf Maschkes Text bezogen haben, nationalsozialistische Affinität zu unterstellen. Wenn ich Maschke in den Kontext der deutschen Ostforschung gestellt habe, dann ging es mir darum, das geschichtswissenschaftliche Umfeld dieses Textes zu verdeutlichen, der vermutlich schon vor Maschkes Rückkehr aus der Krieggefangenschaft zumindest als Konzept existierte. Mit guten Gründen hat Marian Biskup bereits 1992 dass scharfe Urteil von Henryk Olszewski, das Jasiński zitiert, differenziert[5]. Daß an einer solchen kritischen Perspektive festzuhalten ist, sei hier nachdrücklich unterstrichen. Weder geht es an, wissenschaftliche Leistungen gegen politische Fehltritte aufzurechnen, noch kann die wissenschaftliche Tätigkeit allein an politisch verwerflichen Handlungen gemessen werden, wie es offensichtlich Jasińskis Ansicht ist.
Es stellt sich nun die Frage, worauf dieses kapitale Missverständnis beruht. Ich kann hierin weder einen fundamentalen deutsch-polnischen Konflikt noch einen Generationengegensatz erkennen, denn die Diskussion der letzten Jahre und die hier angedeutete Perspektive Marian Biskups zeigen deutlich, daß diese Kriterien gerade nicht zutreffen. Eher schon geht es um mentale Residuen des Blockdenkens, die nicht an ein Lebensalter gebunden sind; im Zentrum sollten aber – neue oder erneut gestellte – Fragen an den historischen Prozeß jenseits von Legitimationszwängen stehen; das ist der Gegenstand meiner obigen Überlegung.
[1] Vgl. W poszukiwaniu tożsamości: Mazurzy i Warmiacy w XIX i XX, in: »Borussia. Kultura. Historia. Literatura«, Nr. 1/1992, S. 3–15.
[2] Janusz Jasiński, Kilka uwag o artykule Jörga Hackmanna, »Potrzeba zmiany«, in: »Kommunikaty Mazursko-Warmińskie« 2001, Nr.2, S.277–281.
[3] Erich Maschke, Preußen.Das werden eines deutschen StammesnamensDomus Hospitalis Theutonicorum. Europäische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsätze aus den Jahren 1931–1963, Bonn 1970, S. 158–187.
[4] Marian Biskup, Das Problem der ethnischen Zugehörigkeit im mittelalterlichen Landesausbau in Preußen. Zum Stand der Forschung, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 40, 1991, S. 3–25, hier S.5 vgl. auch polnisch: ders., Etniczno-demograficzne przemiany Prus Krzyżackich w rozwoju osadnictwa w średniowieczu. (O tzw. mowym plemeniu Prusaków), in: »Kwartalnik Historyczny« 98, 1991, Nr.2, S.46–47, hier S. 47: »wnikliwa rozprawa«.
[5] Marian Biskup, Reprezentanci kręgu królewskich historyków. Erich Maschke i Karl Kasiske, in: Dzieje historiografii Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich 1920–1939 (1944). (Kierunki, ośrodki, najwybitniejsi przedstawiciele). Materiały sesji w Toruniu 15–16 IX 1991 r., hg. von Andrzej Tomczak, Toruń 1992, S. 135–162; dort zu Maschke S. 135–149, zu dem Zitat von Olszewski S. 148.