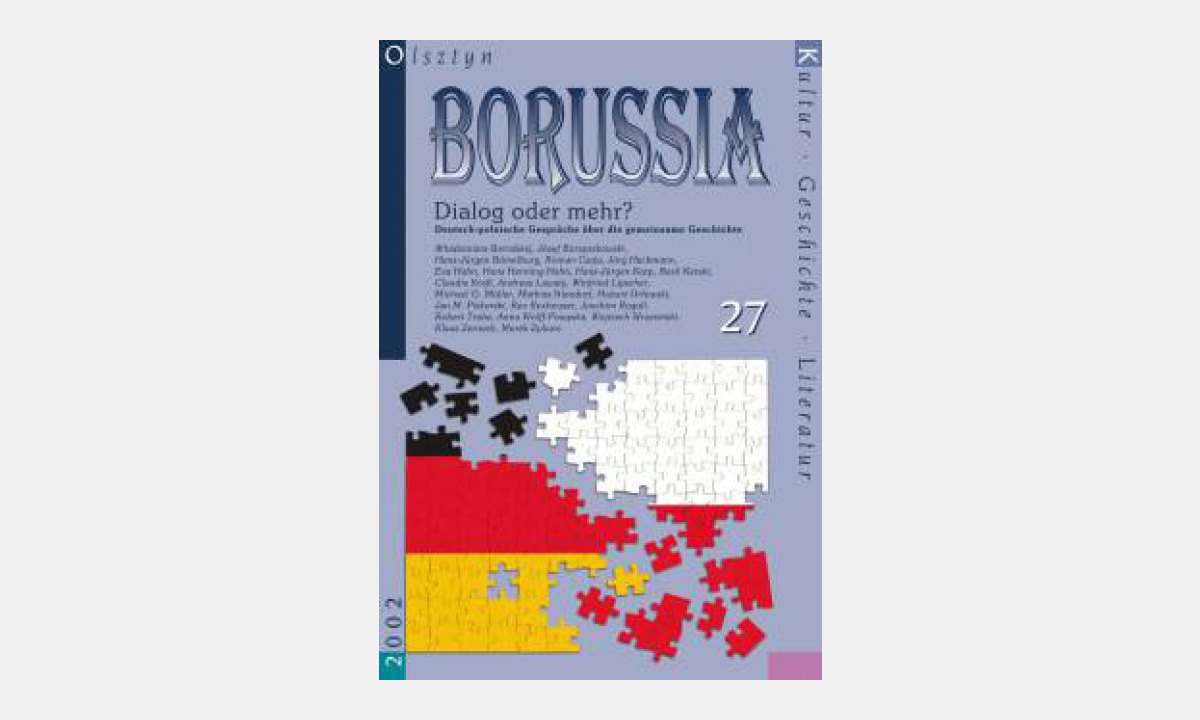Ein Jahrzehnt nach Unterzeichnung der Verträge von 1990/91 haben die deutsch-polnischen Beziehungen eine bisher ungeahnte Qualität erreicht. Wenn ein Bundespräsident in Warschau zwei Erhebungen gegen die deutsche Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg verwechselt, findet dies in den polnischen Medien längst nicht mehr die Beachtung, die einem Bundeskanzler zuteil wurde, der sich im Kreuzritter-Ornat hatte ablichten lassen. Eine wissenschaftliche Aufarbeitung der deutsch-polnischen Vergangenheit ist damit nicht überflüssig geworden. Doch stehen Historiker nicht länger in der Pflicht, Argumente für nationale Abgrenzung oder Annäherung liefern zu müssen und dabei womöglich selbst eine Vorreiterrolle zu übernehmen.
Anders als die politischen Rahmenbedingungen haben sich die Wissenschaftssysteme in beiden Ländern allerdings nur wenig gewandelt. Ein Ungleichgewicht wird sich auch kaum beheben lassen: Die deutsch-polnischen Beziehungen spielten und spielen für Polen eine größere Rolle als für Deutschland. Während in Polen die Beschäftigung mit dem Nachbarn in die allgemeine Geschichte integriert ist, bleibt sie in der Bundesrepublik einer Spezialdisziplin vorbehalten, deren Vertreter sich nicht erlauben können, ihre wissenschaftliche Tätigkeit ausschließlich einem solchen Themenfeld zu widmen. So müssen Deutsche sich erst einmal den Wissensstand ihrer polnischen Kollegen erarbeiten, bevor sie als Gesprächspartner mehr als nur höfliches Interesse und die landesübliche, freundliche Aufgeschlossenheit erwarten dürfen.
Dabei machen sich Verständigungsprobleme bemerkbar, selbst wenn anders als zu Zeiten der Schulbuchkommission Veranstaltungen unter deutscher Beteiligung ausschließlich auf Polnisch stattfinden oder man sich auf ein »Każdy po swojemu« verständigt. Weniger in Redebeiträgen als in ausgearbeiteten Texten spiegeln sich unterschiedliche Wissenschaftskulturen wider. Eine ausgeprägte Freude an Begriffsbildungen, zumal auf der Basis griechischer und lateinischer Ausdrücke, lässt sich nur schwer in einem Land vermitteln, wo Universitätsprofessoren in ihrem Selbstverständnis für eine historisch interessierte Öffentlichkeit und nicht in erster Linie für ein Fachpublikum schreiben. Hiermit hängt auch ein geringer ausgeprägtes Interesse an Theoriedebatten zusammen.
Eine solche Asymmetrie erschwert den Dialog zwischen deutschen und polnischen Historikern, unabhängig davon, mit welchen Themen sie sich im einzelnen befassen. Deutsche Arbeiten erscheinen im Nachbarland häufig als intellektuelle Glasperlenspiele ohne Relevanz für das Alltagsgeschäft des Historikers, polnische Publikationen in Deutschland über das Sujet hinaus als wenig fesselnd, da überwiegend in der Tradition des Positivismus wurzelnd.[1] Östlich der Oder ist zudem die Dominanz einer politischen Geschichte ungebrochen, gegen die in der Bundesrepublik Anhänger einer historischen Sozial- wie Kulturwissenschaft zu Felde gezogen sind. In jenen Grundsatzdebatten wurden nicht zuletzt auch Generationskonflikte ausgetragen, welche aufgrund eines anders strukturierten Universitätsbetriebes und der damit verbundenen Abhängigkeitsverhältnisse in Polen so nicht denkbar gewesen wären.
Im Dialog zwischen Historikern beider Länder sind jahrgangsspezifische Prägungen zwar wahrnehmbar, für die Forschungspraxis aber von nachgeordneter Bedeutung. Der Autor dieser Zeilen zumindest hat die Erfahrung gemacht, dass Versuche innovativer Behandlung deutsch-polnischer Beziehungsgeschichte generationsübergreifend möglich sind.[2] Wenn im Rahmen seines Forschungsteams kontrovers diskutiert wurde, so verliefen die Fronten nicht zwangsläufig entlang der Nationen- oder Generationen-Grenze – ganz ähnlich offenbar wie später in dem von Włodzimierz Borodziej und Hans Lemberg geleiteten Vertreibungs-Projekt. Der Anspruch des Neuen lag dabei nicht in der Thematik, sondern in der Art ihrer Bearbeitung begründet, wie es bereits die Arbeitsteilung zwischen Deutschen und Polen zum Ausdruck brachte. Eine Abkehr vom Prinzip nationaler Identifikation des Forschers mit seinem Untersuchungsobjekt erscheint durchaus im Sinne des jüngst von Wolfgang Reinhard formulierten Postulats von »Geschichte als Delegitimation« (vgl. »Frankfurter Allgemeine Zeitung« vom 26.11.2001). Positiv bedeutet dies, dass sich Historiker beider Länder ein Stück weit für die Nationalgeschichte des jeweils anderen öffnen und nicht in erster Linie nach dem deutschen Anteil beziehungsweise nach den »Polonica« fragen.
Eine in jüngster Zeit verstärkt genutzte Möglichkeit bedeutet die Ausweitung einer Beziehungsgeschichte auf den Vergleich, wobei deutsche und polnische Akteure nicht zwangsläufig interagiert haben müssen. So finden sich neben zweiseitig angelegten Betrachtungen der Minderheitenproblematik oder der nationalen Verbände im Kaiserreich (S. Grabowski) auch Gegenüberstellungen der Vertreibung aus Ostpolen und aus Ostdeutschland (Geschichtswerkstatt KARTA) oder der Integration von Vertriebenen in Volkspolen und der Sowjetischen Besatzungszone (Ph. Ther). Selbst diachron ist ein Vergleich deutscher und polnischer Bevölkerungsplanung vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg gewagt worden (M.G. Esch). Von einer – sicher generationsbedingten – Unbefangenheit ist es allerdings nur ein kleiner Schritt zur Unbedarftheit, sofern die traditionskritische Überprüfung vermeintlich neuer Positionen unterbleibt. So wie es zu begrüßen ist, wenn Polen als Teil Europas auch in größer angelegte Untersuchungen einbezogen wird, so problematisch erscheint es, wenn damit quasi durch die Hintertür bereits für überwunden geglaubte Klischeevorstellungen eines Ost-West-Gefälles wieder eingeführt werden.[3]
Der Vergleich selbst stellt bekanntlich eine Betrachtungsweise, keine Methode dar. In dieser Hinsicht scheint es, dass die Möglichkeiten einiger nicht sonderlich aktuell erscheinender Ansätze noch keineswegs ausgeschöpft sind. So fehlen für die Zwischenkriegszeit noch immer fundierte sozio-ökonomische Untersuchungen über das deutsch-polnische Grenzgebiet. Selbst das Standardthema, was »deutsch« und »polnisch« im Laufe der Jahrhunderte bedeutet haben, hält noch reichlich Herausforderungen bereit. Postmodern inspirierte Dekonstruktivisten mögen sich ausgewählter Texte der Elitenkultur annehmen; Desiderat bleibt die Abkehr von der zentralen, normativen Ebene und eine Hinwendung zu kleineren Untersuchungseinheiten bis hin zum Alltag zwischenmenschlicher Beziehungen. Auch wenn gerade die fachübergreifenden Konzepte von »Ostforschung« und »polska myśl zachodnia« den Schluss nahelegen, dass Interdisziplinarität keinen Wert an sich bedeuten muss, lohnt es sich, nach Anregungen in den Nachbarwissenschaften Ausschau zu halten. Dies um so mehr, als die polnischen Sozialwissenschaften stärker als in Deutschland historisch ausgerichtet sind, wie unlängst wieder eine innovative, auf Oral History beruhende Studie über das Wilna-Gebiet unter Beweis gestellt hat.[4]
Warum sollten nicht aus der historischen Beschäftigung mit einem der ethnischen Mischgebiete Ostmitteleuropas Anstöße zur Theorie- und Modellbildung für die internationale Forschung ausgehen? So wie ein stärkeres methodisches Interesse in der Geschichtswissenschaft vor allem auf polnischer Seite wünschenswert erscheint, so bleibt als Aufgabe für die deutsche Seite, zu einer besseren Kenntnis der polnischen Geschichte beizutragen – nicht nur unter Politikern.
[1] Vgl. die grundsätzlichen Ausführungen von Krzysztof A. Makowski in seiner Rezension von Cornelia Östreichs Dissertation: »Des rauhen Winter ungeachtet...«. Die Auswanderung Posener Juden nach Amerika im 19. Jahrhundert, Hamburg 1997, in: »Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego« 2000, Nr. 4, S. 539–544, hier S. 543 f.
[2] Vgl. Polacy i Niemcy między wojnami. Status mniejszości i walka graniczna. Raporty władz polskich i niemieckich z lat 1920–1939, wyd. Rudolf Jaworski [*1944] i Marian Wojciechowski [*1927], opr. Mathias Niendorf [*1961] i Przemysław Hauser [*1942], 2 Bde. München/New Providence/London/Paris 1997. Mitinitiator des Projektes war Martin Broszat [1926–1989].
[3] Vgl. den Festvortrag Jürgen Kockas zum Gründungsjubiläum des Herder-Institutes, Das östliche Mitteleuropa als Herausforderung für eine vergleichende Geschichte Europas, in: »Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung« 49 (2000), S. 159–174, mit der nicht falschen, aber in seiner Kürze erklärungsbedürftigen Feststellung: »Wenn man das deutsche Bürgertum des 18. oder 19. Jahrhunderts mit dem Bürgertum westeuropäischer Länder vergleicht, erscheint es in mancher Hinsicht als defizitär. Wenn man es mit dem Bürgertum in Polen oder Ungarn vergleicht, erscheint es dagegen ungemein bürgerlich, kraftvoll und ausstrahlungsstark« (S. 168).
[4] Vgl. Kaja Kaźmierska, Doświadczenia wojenne Polaków a kształtowanie tożsamości etnicznej. Analiza naracji kresowych, Warszawa 1999.