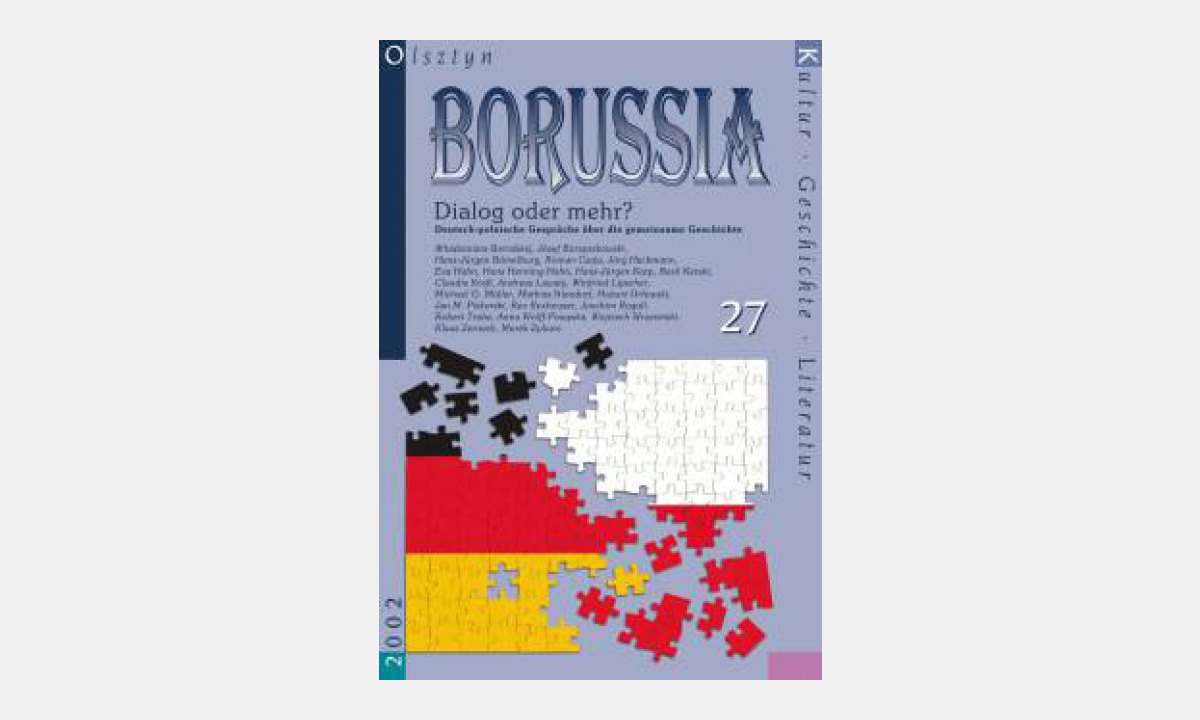Übersetzung: Herbert Ulrich
Zum wiederholten Male zeigt sich, dass die Gegenwart die Vergangenheit beeinflußt, zumindest ihre Wahrnehmung. Daher verursachte der Abbruch des »Eisernen Vorhanges« in den Jahren 1989/1990 eine enorme Veränderung in der Sicht auf die – gegenwärtige und historische – Situation Polens und Ostmitteleuropas überhaupt. Das ist eine unzweifelhafte Tatsache, die sowohl im sog. Westen als auch in Polen selbst beobachtet werden kann – ich rede deshalb vom »sogenannten Westen«, weil dieser geographisch im Norden, ja sogar – wie im Falle Finnlands – durchaus noch weiter östlich liegen kann.
Schon früher bewirkten die politischen und wirtschaftlichen Realitäten, dass wir für die in Freiheit und immer größerem Wohlstand lebenden Gesellschaften der westeuropäischen Länder oft als Fremde galten – als arme, abhängige, nur schwierig zu kontaktierende und deshalb eher mythische als wirkliche Völker. Nicht anders verhielten sich auch die westeuropäischen Eliten, die sich von Natur aus mehr für die Welt interessierten und als solche offener und mobiler waren. Auch für sie gehörten wir im Prinzip nicht zu »Europa«, das fast immer nur mit dem Territorium der Europäischen Union sowie Skandinavien gleichgesetzt wurde. Noch vor wenigen Jahren verwiesen die danach befragten Westberliner, ob es von Berlin näher nach Mailand oder nach Warschau sei, fast ohne Zögern auf die italienische Stadt.
Selten nur vernahm man am Rhein, an der Seine, der Themse oder am Potomac Stimmen, die appellierten, diesen Teil Europas nicht zu vergessen, der ja schließlich nicht freiwillig unter kommunistische Herrschaft geraten war. Dass diese Stimmen nur Rufer in der Wüste waren, beweist unter anderem das bekannte Lehrbuch für Europäische Geschichte, das in Frankreich an der Wende der achtziger und neunziger Jahre auf Initiative von Frederic Delouche erschien (Paris 1992: Hachette) und dann in fast alle europäischen Sprachen übersetzt wurde, auch ins Polnische (Warszawa 1994: WSiP). Es zeigt, dass im Bewußtsein der Westeuropäer der Begriff »Europa« im allgemeinen mit den Grenzen der Europäischen Union identifiziert wurde.
Andere Ansichten fanden kein Gehör, und zwar sowohl im Westen als auch im Osten. Auf beiden Seite des »Eisernen Vorhanges« wurden solche Meinungen nämlich, vor allem in den fünfziger und sechziger Jahren, als Versuche gewertet, die »Geschlossenheit der eigenen Reihen« aufzubrechen, nur dass man im Westen über diese Dinge immerhin reden und schreiben konnte, während bei uns die kommunistischen Machthaber das »europäische Problem« wie das Feuer fürchteten. Daher wurden in den sog. Volksdemokratien oft nicht diejenigen westlichen Politiker und Wissenschaftler angegriffen, die Seite an Seite mit den Unversöhnlichen, d.h. den authentischen Revanchisten schritten, an denen es in Deutschland ja nicht fehlte, sondern gerade diejenigen, die aus der Reihe tanzten. Ein Modellbeispiel für ein solches Verhalten lieferte die Deutsche Demokratische Republik, wo eigentlich alle fortschrittlicheren – im Sinne von offener und pluralistischer gesinnten – westlichen Historiker und Gelehrten ihr Fett abbekamen, wodurch natürlich – leider – das Gewicht der DDR-Angriffe gegen die wahren Nazis geschmälert wurde. In diesem Zusammenhang sei nur an die Angriffe gegen Herbert Ludat und sogar gegen Klaus Zernack erinnert, den man als »Versöhnungsdemagogen« hinzustellen versuchte!
Aber auch wir in Polen waren in dieser Hinsicht nicht ohne Schuld, insbesondere was unsere Unterlassungssünden betrifft. Zwar druckten die seriösen Zeitschriften nach 1956 keine Anklagen mehr, dass die Werke über die europäischen Wurzeln der polnischen, tschechischen oder ungarischen Kultur nur einen Versuch darstellten, die polnisch-sowjetische Freundschaft zu verwässern, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass solche Arbeiten überhaupt nicht nach Polen gelangten. Es ist wahr, dass Gerard Labuda 1956 einen Artikel über die neuen Tendenzen in der westdeutschen Historiographie veröffentlichen konnte, aber die Werke von Heinrich Felix Schmid oder Herbert Ludat blieben einem breiteren Leserkreis eigentlich unzugänglich. Ihre Übersetzung kam wegen ihrer eindeutig antikommunistischen oder zumindest prodemokratischen Aussage überhaupt nicht in Frage. Östlich der Elbe herrschte ja die »Volksdemokratie«, d.h. es fehlte an den grundlegenden demokratischen Freiheiten.
Aus ähnlichen Gründen, aber auch weil sich die polnische Historiographie im Kreise ihrer eigener Probleme festgefahren hatte, erreichten auch die wenigen angelsächsischen Werke zur europäische Problematik den polnischen Leser und damit auch den Durchschnittshistoriker nicht. Wer kannte bei uns denn schon die hervorragenden und wichtigen Arbeiten von Geoffrey Barraclough, Archibald Lewis oder Norman Pounds? Sogar der »unsere polnische Seele mit Honig labende« Norman Davies erreichte uns zunächst nur über »feindliche« Radiosender und durch Samisdatdrucke in Kleinstauflage; erst gegen Ende der achtziger Jahre wurde er offiziell verlegt, allerdings mit zahlreichen Eingriffen der Zensurbehörde, die aus der heutigen Perspektive nur noch schwer nachvollziehbar sind, insbesondere weil die Krakauer Zeitschrift »Arka« (»Die Arche« – 1989, Nr. 28) beinahe sofort ihre genaue Liste veröffentlichte.
»Europa« interessierte sich nicht für uns, aber auch wir selbst, obwohl – oder vielleicht gerade weil – wir uns immer als hundertprozentige Europäer empfanden, beschäftigten uns nicht besonders mit der gesamteuropäischen Problematik, sondern vergruben uns immer tiefer in die eigene Vergangenheit, rissen immer wieder neu unsere nationalen Wunden auf, diskutierten ewig die gleichen Probleme und forderten vom »Rest« Europas dann bedingungslose Anerkennung und aufrichtige Bewunderung für unser Heldentum. In unserer par excellence nationalen Geschichtsschreibung, die entweder »zur Erquickung der Herzen« oder zur Ermahnung verfaßt wurde, zählten die europäischen und erst recht die globalen Probleme im Prinzip nicht, weil sie – was durchaus verständlich ist – nicht in unseren kulturellen Code aus dem 19. Jahrhundert hineinpaßten.
Zugegebenermaßen bildete die polnische Historiographie, die allgemein auf ihre Modernität und Offenheit stolz war (notabene: verglichen mit der Geschichtsschreibung in den übrigen Länder des realen Sozialismus entsprach dies zweifellos der Wahrheit), einen schwierigen Diskussionspartner, weil sie alle Probleme letztendlich auf die »polnische Frage« zurückführte, auf den sprichwörtlichen »Elefanten im Verhältnis zur polnischen Frage« (polnisches Sprichwort). Gleichzeitig fehlte – und fehlt – ihr eine breitere Reflexion, auch in methodologischer und methodischer Hinsicht. Immer neue Generationen von Historikern versuchen dieselben Fragen zu beantworten und wenden sich ausschließlich den Quellen zu, während die in unserer Historiographie deutlich vernachlässigte Vergleichsmethode doch ebenfalls eine unerläßliche Bedingung wissenschaftlicher Erkenntnis darstellt (mit Erfolg wurde diese Methode zum Beispiel von Sławomir Gawlas in bezug auf das Mittelalter und auch von Witold Molik in bezug auf das 19. Jahrhundert angewandt).
Die Bemühungen um einen Platz Polens und Ostmitteleuropas im neuen Europa nach 1989 haben bereits zu gewissen Veränderungen geführt. Die polnische Historiographie bricht mit ihrem strikt nationalen Code, und auch westliche Historiker sehen uns immer öfter in Europa. Die frühere These Hegels und Rankes, die die Geschichte Europas auf den romanisch-germanischen Kulturkreis beschränken wollte, stirbt vor unseren Augen. Heute würde kein führender deutscher Historiker mehr schreiben – wie vor fast zwei Jahrhunderten Ranke –, dass vom Gesichtspunkt Europas Lima und New York wichtiger seien als Kiew und Smolensk. Für eine ständig zunehmende Zahl seriöser deutscher Historiker bildet die romanisch-germanische Welt nicht mehr den einzigen Maßstab des Fortschritts, den einzigen Bezugspunkt. Das »slawische« Europa gewinnt seine Souveränität zurück. Wie ich an anderer Stelle unter Bezugnahme auf den indisch-amerikanischen Historiker Gyan Praskash gezeigt habe, schreibt das »Dritte Europa«, d.h. unser Teil Europas, seine eigene Geschichte, die nicht mehr nur eine Geschichte von Verwestlichungsprozessen darstellt. Zwei Jahrhunderte nach der Entstehung der modernen Historiographie hat Ostmitteleuropa seinen souveränen Platz in Europa gefunden, und Themen im Zusammenhang mit dem slawischen Osteuropa bilden immer öfter den Gegenstand lebendiger wissenschaftlicher Diskussionen (Robert Bartlett, Norman Davies, Klaus Zernack, Michael Borgolte, Frank Kämpfer u.a.). Dabei können wir allerdings – dies müssen wir ehrlich zugeben – nicht viele polnische Stimmen vernehmen (in diesem Zusammenhang verdient der Standpunkt von Henryk Samsonowicz und Jerzy Kłoczowski unsere Aufmerksamkeit), und diejenigen, die sich doch hören lassen, sind eher ziemlich traditionell, um nicht zu sagen banal, besonders was die europäische Rolle Rutheniens und Rußlands betrifft (dies ist zweifellos ein Ergebnis unserer Komplexe den Russen gegenüber).
Überhaupt scheint die polnische Historiographie gar nicht bemerkt zu haben, dass im Zusammenhang mit der neuen Situation in Europa viele Fragen entstanden sind, die eine schnelle Antwort erfordern. Hier sei nur an solche Themen erinnert wie die geschichtliche Rolle der europäischen Orthodoxen, der Juden und sogar der Moslems. Das ist schade, denn in dieser Sache müßte die polnische Historiographie doch besonders viel zu sagen haben.
Kaum erkennbar sind in unserer Historiographie auch die neuen pluralistischen Strömungen, im Rahmen derer Europa als ein Ensemble souveräner und gleichberechtigter, obschon unterschiedlicher Regionen verstanden wird. Wir haben uns – mit Recht – der deutschen These widersetzt, die uns höchstens die Rolle jüngerer, noch nicht volljähriger Brüder zuerkennen wollte, betrachten aber selber die das Gebiet der früheren polnisch-litauischen Adelsrepublik bewohnenden Völker oft noch durch die nationalistische Brille. Besonders deutlich wird das in Bezug auf die Weißrussen (aber auch die Ukrainer), denen nicht nur von der gewöhnlichen öffentlichen Meinung in Polen manchmal das Recht bestritten wird, sich als eigene Nation zu bezeichnen.
Ein wichtiges Element der polnisch-deutschen historiographischen Annäherung bildet die Aufnahme Polens in die Familie der demokratischen Nationen, wodurch der kulturelle Code der östlich und westlich der Oder (oder der Elbe, die Deutschland immer noch zu teilen scheint) lebenden Völker einander wieder ähnlicher wurde. Im Rahmen der gleichen demokratischen Sprache fällt uns die Verständigung zweifellos leichter, insbesondere weil die meisten von uns die grundlegende Tatsache akzeptieren, dass eine demokratische Historiographie nicht mit einer Stimme sprechen kann oder soll, weil sie eine Widerspiegelung der pluralistischen Gesellschaft darstellt. Wichtig ist nur, dass diese Verschiedenheit der Stimmen nicht entlang der nationalen Trennungslinie verläuft. Die ihren Platz suchende postnationalistische oder postnationale Historiographie darf keine früheren autoritären Wahlentscheidungen darüber übernehmen, was wichtig, was unwichtig oder weniger wichtig ist, sondern sie muß ihren Pluralismus als selbstverständliche Tatsache annehmen (Karin Hausen). Das heißt jedoch nicht, dass ein pluralistisches Chaos die erzwungene Einheit ersetzen muß, wovor Arno Borst gewarnt hat. In einem guten Orchester ist Platz für viele verschiedene Instrumente. Dort gibt es auch einen besonderen Platz für den Dirigenten, dessen Aufgabe jedoch nicht darin besteht, den Klang des Orchesters »gleichzuschalten«, sondern nur eine gewisse Ordnung zu sichern. Michael Borgolte schreibt mit Recht, die Aufgabe der historischen Wissenschaft bestehe gerade darin, diese Vielfalt zu ordnen. Zuzustimmen ist auch Otto Gerhard Oexle, dass wir es als Historiker nie mit einer Einheit im normativen Sinne zu tun haben, sondern mit Hypothesen, denen immer bestimmte, deduktiv abgeleitete Alternativen mit keineswegs geringerem Wert und Rang gegenübergestellt werden können.
Insgesamt sehe ich die Veränderungen in den polnisch-deutschen historiographischen Beziehungen nach 1989 also recht optimistisch. Das bedeutet selbstverständlich nicht, dass ich die Gefahren unterschätze. Aber ich möchte an dieser – zeitlich und räumlich begrenzten – Stelle nicht auf Einzelheiten eingehen, über die ich ja schon mehrfach gesprochen und geschrieben habe. Zu den größten Gefahren gehört meiner Meinung nach die Entstehung neuer Tabus, die – im Rahmen des neuen Kanons der »political correctness« – den Platz der früheren »weißen Flecke« einnehmen. Gefährlich erscheint mir auch die Übernahme nicht genügend durchdachter früherer deutscher Thesen durch polnische Historiker. Viele davon wurzeln nämlich noch in der nationalistischen und nationalsozialistischen Epoche und bedürfen selbst einer dringenden Revision. Überhaupt muß wohl der These zugestimmt werden, daß die Daseinsberechtigung eines Historikers in ständigem Revisionismus besteht (Stephen Howe). Ein Historiker, der die Notwendigkeit ständiger Revidierung der bisherigen Thesen nicht erkennt, hört auf, ein Wissenschaftler und Gelehrter zu sein, und fällt auf die Positionen eines Chronisten zurück. Die deutschen Historiker der jüngeren und der älteren Generation vollziehen gegenwärtig eine vielsagende Revision des von der Historiographie des imperialistischen und nazistischen Deutschlands geschaffenen Bildes und gelangen zu Schlüssen, die notwendigerweise für die gesamte historische Wissenschaft relevant werden, welche schließlich in Deutschland begründet wurde. Schade ist nur, sie sich manchmal statt auf das Meritum auf bloß biographische Themen konzentrieren – dies betrifft insbesondere die jüngsten Historiker – und sich mit einer Arroganz äußern, wie sie für diejenigen charakteristisch ist, die das »Glück der späten Geburt« hatten (Manfred Hettling). Zu bedauern ist auch, dass man in Polen immer noch allzu selten das Bedürfnis nach einer Revision der Thesen unserer Historiographie verspürt, obwohl darin doch sicher vieles zu revidieren wäre, um nur – mit Stefan Kieniewicz – die Notwendigkeit einer neuen Sicht auf die Rolle der Historiker in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu erwähnen.