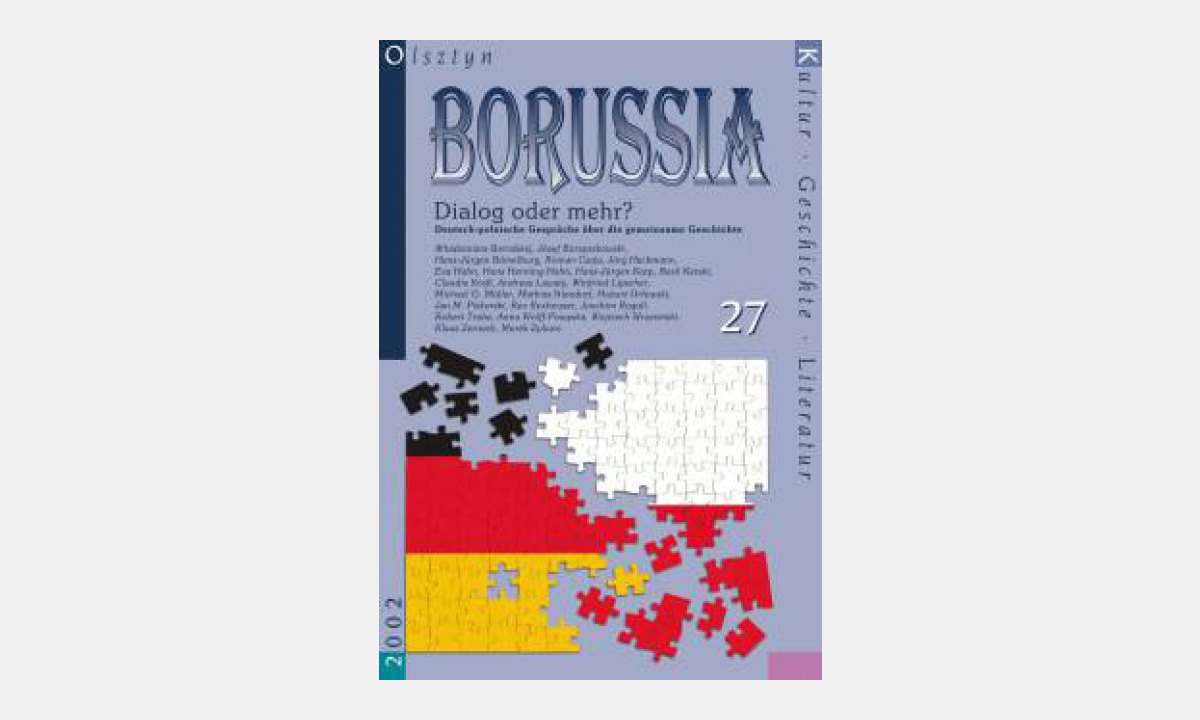Was soll man vom Dialog zwischen zwei nationalen Historiographien erwarten? Viel, wenn es darum geht, die Beziehungsgeschichte zwischen zwei Nationen professionell angemessen zu bearbeiten, und zwar möglichst gemeinsam. Nicht zuviel aber, was die Intensität und die öffentliche Resonanz von regelmäßiger Kooperation und Kommunikation zwischen nationalen Historikermilieus betrifft. Zwischen Polen und Deutschen hat sich der Historikerdialog nach 1989 vielleicht weniger spektakulär entwickelt, als mancher erhofft haben mag. Doch hat dieser Eindruck vielleicht mehr mit überzogenen Erwartungen zu tun als mit wirklich enttäuschenden Ergebnissen. Die Tatsache, daß neue, früher sozusagen blockierte Themen mit neuen Methoden gemeinsam bearbeitet wurden, läßt sich kaum bestreiten, auch nicht, daß das in neuen institutionellen Formen und in einem ständig sich verjüngenden Kreis von HistorikerInnen geschieht. Der Übergang vom Dialog zur praktischen Zusammenarbeit, von dem seit den 1980er Jahren als Zukunftsaufgabe die Rede war, hat wirklich stattgefunden. Nicht nur das Großunternehmen zum »Komplex der Vertreibung« zeugt davon, sondern auch weniger öffentlichkeitswirksame Gemeinschaftsprojekte zur historischen Identitätsforschung, zum sozialgeschichtlichen Vergleich oder zur Geschlechtergeschichte. Vor allem aber: Im deutsch-polnischen Fall ist der Nach-Wende-Dialog auf besonders hohem Niveau gestartet, und die Fortschritte seit 1989 nehmen sich auch deshalb relativ klein aus, weil die in den knapp zwanzig Jahren davor erzielten Fortschritte um so größer waren. Jedenfalls gilt das für den Dialog über bilaterale Beziehungsgeschichte im strikten Sinn. Auch schon vor ’89 haben deutsche Historiker ausführlicher und systematischer mit polnischen Kollegen über Beziehungsgeschichte diskutiert als mit Kollegen in Frankreich, der Schweiz oder den Niederlanden; auch schon vor ’89 hat gerade dieser bilaterale Dialog überkommene nationale Deutungsmuster schneller und gründlicher verändert als der mit anderen Nachbarn. Bei dem riesigen Nachholbedarf im polnisch-deutschem Fall war das natürlich auch nötig, und bei weitem nicht alle Blockaden haben sich letztlich ausräumen lassen. Doch konnte man, nachdem 1989 die politischen Hürden gefallen waren, gleich mit solchen gemeinsamen Unternehmen starten wie sie im deutsch-tschechischen Verhältnis bis auf weiteres nicht einmal zu denken sind. Im übrigen, man kann auch den Rückgang des gegenseitigen Interesses in Teilen der Historikerschaft als eine Art positiver Normalisierung deuten: Wenn z.B. jüngere HistorikerInnen in beiden Ländern sich mit methodisch innovativen Projekten heute eher der baltischen, litauischen oder galizisch-ukrainischen Geschichte zuwenden als der der deutsch-polnischen Beziehungen, so bedeutet das eine produktive Horizonterweiterung, nicht ein Verlust.
Nicht alles ist deshalb schon auf gutem Weg. So bleibt die Ungleichgewichtigkeit der gegenseitigen Wahrnehmungen und des gegenwärtigen Interesses nach 1989 wie nach 2001 ein Problem. Das heißt, noch immer ist die Beschäftigung mit der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte weitgehend eine Domäne, die man in Deutschland gerne spezialisierten »Ostmitteleuropa-Experten« oder – was prekärer ist – der bundesgeförderten Deutschtumsforschung überläßt. Nur sehr wenige »Allgemeinhistoriker« haben, wie Jürgen Kocka in Berlin, die Kooperationsmöglichkeiten mit polnischen Kolleginnen als Chance für eine vergleichende Geschichtswissenschaft jenseits der Nationalhistorie erkannt und Konsequenzen daraus gezogen. Auch wissenschaftspolitisch ist die deutsch-polnische Historikerkooperation nach NATO- und EU-Osterweiterung eher im Abwind. Es scheint, ironisch genug, zu wenige »heiße Eisen«, zu wenige Kontroversen in der deutsch-polnischen Historikerdebatte zu geben, um – wie in Frühzeiten der Schulbuchkommission – politische Aufmerksamkeit zu sichern. Die vielen ausgezeichneten ExpertInnen der jüngeren Generation, die sich in den 1980er und 90er Jahren für »unsere« Themen engagiert und hochprofessionell qualifiziert haben, bekommen das schmerzlich zu spüren. Ihre professionelle Zukunft ist ungewiß.
Weit weniger Sorgen begründet dagegen die Frage nach neuen Arbeitsfeldern, guten Themen und personellen Ressourcen. Die Tatsache, dass nicht alle offenen Fragen der bilateralen Beziehungsgeschichte nach 1989 mit gleicher Intensität angepackt wurden, muß nicht beunruhigen. Zu der »neuen Freizügigkeit« gehört eben auch, daß man Fragestellungen und Kooperationen nach anderen Perspektiven als denen der nationalen Beziehungsgeschichte entwirft. Das Prinzip der nationalen Bilateralität, das bis 1989 politisch notwendig und wissenschaftlich produktiv war, kann und soll jetzt aufgegeben werden – zugunsten von Forschungen mit anderen territorialen Bezügen: lokal- und landesgeschichtlichen, aber auch solchen mit großregionalen, über gleich mehrere Nationen hinweg vergleichenden Fragestellungen.
Was dabei besonders dringlich ist, wird jeder von uns anders beurteilen. Die Mediävisten mögen an eine großräumig vergleichende, von Brandenburg bis Weißrußland reichende Betrachtung des hochmittelalterlichen Landesausbaus denken, die Frühneuzeitler an die Leitthemen Ständegeschichte oder Konfessionalisierung; für das 20. Jahrhundert ist die Gesellschaftsgeschichte im Sozialismus (deutsche, polnische, vergleichende) neu zu entdecken. Mir erscheint dabei allgemein wichtig, neue Parameter des Vergleichs zu entwickeln. Zu lange haben wir uns durch die auf Nordwesteuropa bezogene Historiographie sozusagen vorschreiben lassen, was als »eigentlich« europäische Entwicklung und was als Geschichte von »Rückständigkeit« zu gelten hat. Dagegen müssen wir versuchen die (über weite Strecken gemeinsamen) polnischen und deutschen »Sonderwege« als Entwicklungen zu eigenem Recht zu verstehen und mit neuen Begriffen vergleichend einzuordnen. Außerdem scheint ein guter Weg zu sein, was Dan Diner mit seiner Vision einer »neuen Diplomatiegeschichte« fordert, nämlich zu untersuchen, welche anderen Akteure neben den nationalen oder imperialen Regierung europäische Entwicklungen in der Moderne bestimmt haben – z. B. transnationale Öffentlichkeiten oder Netzwerke konfessioneller, sozialer, politischer oder professioneller Gruppen.
Nicht zuletzt sollten die HistorikerInnen darauf reagieren, dass der Dialog in den Geschichtswissenschaften eben doch etwas anderes ist als die Entwicklung der weiterhin scharf geschiedenen nationalen Gedächtniskulturen. So weit sich die wissenschaftlichen Beurteilungen und Darstellungen der Beziehungsgeschichte seitens polnischer und deutscher HistorikerInnen inzwischen angenähert haben mögen – es bleibt eine Tatsache, daß Polen und Deutsche radikal verschiedene Erinnerungen an die gemeinsame Geschichte haben, ob im Blick auf den Zweiten Weltkrieg oder auch so entfernte Zusammenhänge wie die Geschichte des Deutschen Ordens. D.h., Polen und Deutsche erzählen ihre jeweilige Geschichte – und auch die gemeinsamen Anteile daran – je anders, und sie ziehen daraus sehr verschiedene Konsequenzen für ihren sozialen und politischen Habitus, ihre Zukunftsvisionen. Historiker können untersuchen, warum dies so ist, aus welchen Gründen welche Themen jeweils den Stoff für das kollektive Gedächtnis der Nationen liefern und welche politischen und kulturellen Funktionen bestimmte Formen der Erinnerungen im jeweiligen nationalen Kontext haben mögen. Die lieux de mémoire zumal die zwischen Polen und Deutschen getrennten, bieten ein spannendes Arbeitsfeld.
Unter den Themen von morgen werden unweigerlich aber auch wieder manche der Themen von vorgestern sein. Wer von uns älteren Historikern der Debatte um Grass’ »Wilhelm Gustloff« zuhört, traut oft seinen Ohren nicht: Man könnte meinen, es habe nach 1945 »nie« ein wissenschaftliches oder öffentliches Interesse an der Vertreibung von Deutschen gegeben, deren Schicksal sei im Geiste politischer Korrektheit der Deutschen gegenüber ihren östlichen Nachbarn »immer verschwiegen« worden, die schonungslose (um nicht zu sagen »brutalst mögliche«) Aufklärung stelle die Zukunftsaufgabe von Völkerverständigung durch Wissenschaft dar, usw. Allzu tief scheinen unsere Bemühungen seit den 70er Jahren, den Blick für die Wirkungszusammenhänge in den Katastrophen der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte zu schärfen, nicht gewirkt zu haben – jedenfalls bei weitem nicht so tief, wie es am Ende der 1980er Jahre scheinen mochte. Die Debatten um die beziehungsgeschichtlichen Kontexte unserer jeweiligen nationalen Erfahrungen werden also weiter, vielleicht auch ganz neu geführt werden müssen.