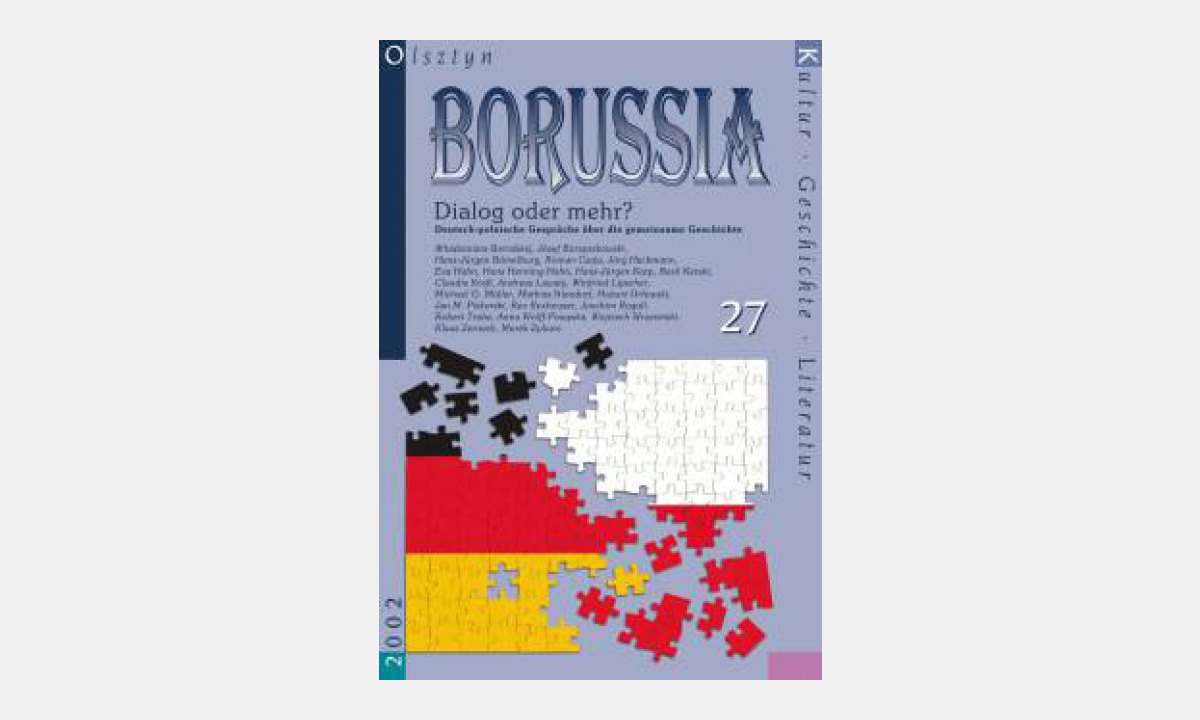Die moderne Geschichtswissenschaft ist von ihrer Entstehung und Fachgeschichte her eine »vorzüglich nationale Wissenschaft«. Ansätze, dies im Zuge einer Professionalisierung in den letzten Jahrzehnten zu verändern, stoßen an Barrieren: Einerseits ist das Fach bis heute national organisiert; die meisten Lehrstühle an deutschen wie polnischen Universitäten sind Lehrstühle für deutsche resp. polnische Geschichte, die dort lehrenden Historiker sind zu über 90% Bürger des jeweiligen Staates. Weiterhin schreiben diese Historiker durchweg für ein nationales Publikum, das bestimmte Rezeptionsgewohnheiten und methodische Ansätze teilt und einen auch national geprägten Erwartungshorizont hat. Jeder, der an internationalen Konferenzen teilnimmt, macht die Erfahrung, dass Tagungsstruktur, Themenwahl, inhaltliche Gewichtung wie Diskussionsstil zu einem erheblichen Teil national präfiguriert sind. Schließlich ist die heute aktive Historikergeneration mehrheitlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozialisiert und wissenschaftlich akkulturiert worden, in einer Zeit, in der Nationalstaat und Nationalkultur wie nie zuvor unbezweifelte Dominanten darstellten. Wie wir es auch drehen und wenden, für fast alle von uns ist die nationale Historiographie – vielleicht stärker noch als vor 100 Jahren – die Bezugsgröße.
Vor diesem Hintergrund ist die angestoßene Diskussion um so verdienstvoller; die Aufgabe, nationale Geschichtsbilder und –kulturen kompatibel zu machen, wird in Zukunft Historiker beschäftigen. Nach 1990 ist eine Diskussion der verschiedenen Geschichtsbilder erleichtert worden, zugleich hat sich an den oben geschilderten Konstituenten von Geschichtswissenschaft in einer bürgerlich-pluralistischen Gesellschaft jedoch kaum etwas geändert. Was tun?
Grenzen der Landesgeschichte. Nahe liegt der Versuch, eine Relativierung der nationalen Perspektive durch einen regionalen (Landesgeschichte) oder einen vergleichenden oder nichtnationalen thematischen Zugriff (Migrations-, Ständegeschichte etc.) zu erreichen. Diese Wege sind in den letzten Jahren beschritten worden, bilden jedoch keinen Königsweg, da sie neue Probleme aufwerfen. Dies sei am Beispiel der Landesgeschichte erläutert: Erstens arbeitet aus historischen Gründen die Landesgeschichte in Deutschland und in Polen mit unterschiedlichen Zugriffen; Schlesien und »Śląsk« bezeichnen im Deutschen und im Polnischen einen unterschiedlichen Kulturraum, von Pommern oder »Pomorze«, »Warmia i Mazury« oder »Ost- und Westpreußen« ganz zu schweigen. Hieraus resultierende terminologische Probleme lassen sich nur durch Offenheit für den jeweils anderen geographischen Zugriff und durch die methodisch geschärfte Überlegung, welcher Zugriff sich für welche Fragestellung eignet, vermeiden. »Pomorze« bzw. der »südliche Ostseeraum« mag ein sinnvoller Zugriff für die Wirtschaftsgeschichte sein, »Ermland und Masuren« für die Beschreibung der polnischen Nationalbewegung bzw. die Beschreibung der neuen Regionalidentität nach 1945 und »Ostpreußen« für Verwaltungsgeschichte und Elitenkultur der Region.
Der landesgeschichtliche Ansatz ist auch deshalb nicht immer kompatibel, weil die Anknüpfungspunkte aus der jeweiligen Nationalgeschichte unterschiedlich dicht sein können. So eröffnet die deutsche Geschichte nur begrenzte Zugänge zur großpolnischen Landesgeschichte, umgekehrt führen von der polnischen Geschichte kaum Wege zur schlesischen oder pommerschen Landesgeschichte. Für Landesgeschichte als binationales Projekt erscheinen v.a. solche Regionen geeignet, in denen sowohl die gemischten Eliten als auch die landesgeschichtlichen Strukturen Anknüpfungsmöglichkeiten von beiden Seiten ermöglichen. Dies gilt z.B. für das historische Königliche Preußen/Westpreußen.
Defizite. Es bleibt zu bemängeln, dass viele deutsche Historiker, die sich mit den deutsch-polnischen Überlappungszonen oder mit der Beziehungsgeschichte beschäftigen, keine polnischsprachige Literatur rezipieren. Besser wird dies unter denjenigen Historikern, die in den letzten 20 Jahren studiert und vielfach polnisch gelernt haben. Hier liegt ein wirklich neues Moment der deutsch-polnischen Wissenschaftsbeziehungen der letzten 200 Jahre; es wird aber noch 30 Jahre dauern, bis die Früchte dieser Wende geerntet werden können.
Anstöße. Da beide Geschichtsschreibungen stark von nationalen Rahmenbedingungen und innerhistoriographischen Trends geprägt sind, finden ähnliche programmatische Diskussionen und Paradigmenwechsel nicht synchron statt. Dies erschwert die Diskussion und sorgt für Verständnisprobleme: So führt die Tatsache, dass die Geschichtswissenschaft in Polen bis heute den Wechsel zur »neuen Kulturgeschichte« nicht vollzogen hat, in Deutschland zu Irritationen über deren »gesellschaftswissenschaftlichen Positivismus«. Ähnliches gilt für die bisher nicht erfolgte Auseinandersetzung mit der »Westforschung« in Polen. Vor diesem Hintergrund erscheint die stete Vergegenwärtigung der eigenen historiographischen Position innerhalb jeder Historiographie unabdingbar.
Wertvoll ist die historiographiegeschichtliche Diskussion über die »Ostforschung« in Deutschland. Wir werden wahrscheinlich in 10–20 Jahren über jeden bedeutenden deutschen Historiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Monographie vorliegen haben und die politischen wie lebensweltlichen Hintergründe des Machens von Geschichte besser einordnen können. Dieser Ansatz sollte auf die Historiker der Jahre nach 1950 ausgedehnt werden; es scheint mir sinnvoll, prägenden Persönlichkeiten wie z.B. Walther Hubatsch oder Gerard Labuda Monographien zu widmen. Noch eine Stufe komplexer ist der interhistoriographische Vergleich, wie ihn bisher vor allem Jörg Hackmann zur preußischen Landesgeschichte angestellt hat. Ähnliches für andere Regionen (Schlesien, Großpolen) oder Themen (Volksgeschichte als Paradigma, Konfessionalisierung und Nationalgeschichte) zu leisten, könnte weiterführen. Notwendig ist hier allerdings ein hohes Maß an Selbstreflexion und Präzision, da der Vergleich in ein unreflektiertes Gleichsetzen einmünden kann.
Wichtige Fortschritte ermöglichten in den letzten 10 Jahren Arbeiten zur preußischen Landesgeschichte, wobei sich vielleicht gerade die Arbeiten am fruchtbarsten erwiesen, die komplementär-perspektiverweiternd »große Themen« der Nachbarhistoriographie aufgriffen. So etwa die Arbeiten deutscher Historiker zum Königlichen Preußen/Westpreußen (Karin Friedrich) oder polnischer Historiker zu Ostpreußen (Robert Traba). Dieser komplementäre Ansatz verdient es, fortgesetzt zu werden. Besondere Aufmerksamkeit verdienen diejenigen Forschungen, die die ausgetretenen Pfade der nationalen Muster von Geschichtsschreibung verlassen und sich um die kreative Aneignung der zentralen Themen der Nachbarhistoriographie bemühen.
Zu überlegen wäre auch, ob nicht die Gremien der wichtigsten Forschungseinrichtungen und führenden Fachorgane stärker international besetzt werden sollten. So wäre eine Aufnahme polnischer Mitglieder in den Beirat der »Stiftung preußischer Kulturbesitz« oder deutscher Historiker in die Redaktionskomitees von »Zapiski Historyczne« oder »Sobótka« sinnvoll.
Methodisch sollte auf unpräzise und wertende Zugriffe wie »Germanisierung« und »Polonisierung« zugunsten präziserer und neutraler sozialwissenschaftlicher Begriffe wie »Inklusion« und »Exklusion«, »Akkulturation« und »Assimilation« verzichtet werden.
Gefahren. Historiographisch hat die marxistisch inspirierte Geschichtswissenschaft für einen längeren Zeitraum ausgespielt: Dies birgt Chancen wie Gefahren. Unter polnischen Historikern hat man sich lange darauf berufen, dass hiervon die eigenen Methoden und Positionen nicht betroffen seien, da man sich seit 1956 oder seit den 1970-er Jahren von marxistischen Ansätzen gelöst habe. Einerseits ist dies zutreffend: Die überwiegende Mehrzahl der polnischen Historiker sah sich spätestens seit den 1970er Jahren nicht mehr als Marxisten. Andererseits verkennt diese Sichtweise, wie tief – und zwar durchaus auch innovativ – marxistische Ansätze die Geschichtspraxis in der VR Polen geprägt und wie sehr sie sich an ältere volksgeschichtliche Positionen amalgamiert haben. So erfolgte die vorrangige Beschäftigung mit – den vielfach polnisch sprechenden – Bauern und Unterschichten in Westpreußen oder in Oberschlesien auch aus marxistischen Positionen heraus, die nun jedoch hinfällig geworden sind. Zu befürchten ist, dass jetzt eine Neufundierung aus einer stärker volksgeschichtlichen Perspektive eintritt, die interhistoriographisch schwer vermittelbar ist.
Andererseits gewinnt in der deutschen Forschung das Paradigma einer »neuen Kulturgeschichte« die Oberhand, wodurch tendenziell die Beschäftigung mit den Eliten, welche schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben, in den Vordergrund rückt. Diese sind in der deutsch-polnischen Kontaktregion jedoch mehrheitlich deutschsprachig, so dass die Beschäftigung mit dem deutschen Faktor vorherrschen kann. So könnte ein Nebeneinander von deutschzentrierter »neuer Kulturgeschichte« und polnischzentrierter Beschäftigung mit Kaschuben, Ermländern, Masuren und Oberschlesiern wieder dominant werden, ein wenig wünschenswertes Szenario. Ein solches »swój do swego« gilt es zu verhindern.