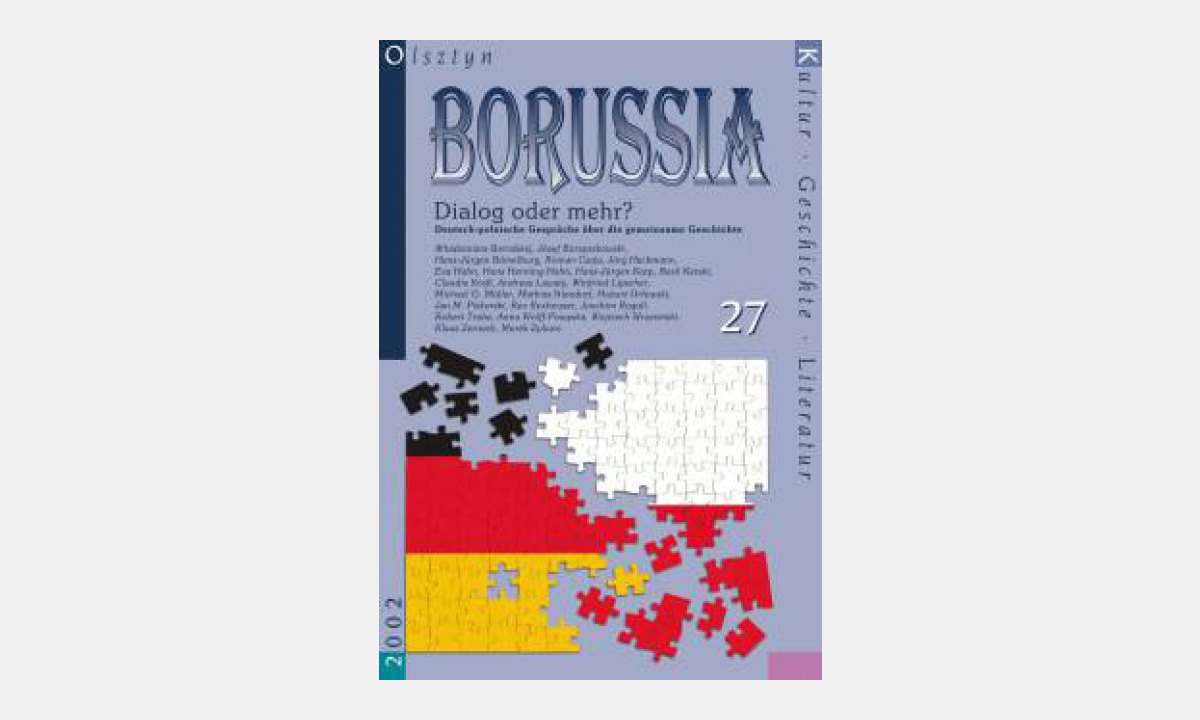Übersetzung: Isabella Such
Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts ist es – an der Oberfläche wie in der Substanz – zu außerordentlichen Veränderungen in den deutsch-polnischen Beziehungen gekommen. Im allgemeinen können diese Veränderungen, vor allem im Bereich der Politik, positiv bewertet werden. Einer Überprüfung unterliegen auch die scheinbar ewigen Stereotypen und zwar auf beiden Seiten, wenn auch stärker auf dem rechten Ufer der Oder. Und dennoch ist immer noch die Elbe als Trennlinie aktuell und läßt die deutsche Gesellschaft und das Bild von ihr auf polnischer Seite stark variieren. An dieser Stelle möchte ich von vornherein darauf hinweisen, das dies eine grobe Vereinfachung darstellt. Die Polen, die Historiker auch eingeschlossen, übernehmen zu oft die alltäglichen innerdeutschen Ansichten, welche die eigenen Probleme einseitig auf der Ebene Ossi-Wessi und Polen-Deutsche im Kontext unserer gemeinsamen, zum Glück nicht immer schlechten bzw. tragischen Vergangenheit zu erklären suchen.
Ich teile die Auffassung Robert Trabas, der in der Einladung zu einer Stellungnahme aufforderte und den Eindruck äußerte, dass
»der deutsch-polnische Dialog« in den Forschungen zur neuesten Geschichte und zu den nationalen Prozessen auf der Stufe des »guten Willens«, ohne eigentliche Vertiefung und Erweiterung des wissenschaftlichen Fragenkataloges »stehengeblieben« sei.
Mehr noch beunruhigt mich eine Erscheinung, die Traba folgendermaßen beschreibt:
»es kommt auch zur Übernahme von alten Thesen der »anderen Seite«, ohne sie einer notwendigen modernen methodischen Kritik zu unterziehen.«
Über die positiven Seiten der neuen Wirklichkeit werden wohl andere zu erzählen wissen. Es gibt viele; vor allem die Freiheit der Themenwahl (Freiheit gab es bei uns fast immer, aber nicht unbedingt unbeschränkt und hinreichend einfach zu haben!) und der Partner in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Es ist jedoch wichtiger sich darauf zu konzentrieren, was Anlaß zu Unruhe gibt, um deren Ursachen zu beseitigen und eine Annäherung der Tatsachen an die Deklarationen zu erleichtern.
Das größte Problem in den Beziehungen zwischen polnischen und deutschen Historikern liegt meines Erachtens in den sehr unterschiedlichen Forschungsbedingungen auf der einen und auf der anderen Seite von Oder und Elbe, sowie auch in einigen immer noch zu starken Traditionen... Einerseits nimmt in Deutschland und in Polen eine Generation von Historikern ihren Abschied, die sich auf traditionelle Weise mit der deutsch-polnischen Problematik befaßt hat. In Deutschland betrifft dies jene, die ihre Forschungen auf der Grundlage ihrer regionalen Herkunft und im Rahmen von Instituten, die sich mit der Erforschung von deutscher Geschichte und Kultur im Osten befaßten, betrieben. – Die Institute sind geblieben, es kamen aber neue Leute, die den Krieg nicht mehr erlebt hatten und oft die Erfahrungen der Väter und Großväter, dieses finstere Kapitel der Geschichte, eher vergessen und sich von Einflüssen des Nationalsozialismus freimachen wollten. Bei uns wiederum sind die jungen Kollegen, die sich ihrerseits von den Erinnerungen der Väter an den Nationalsozialismus und den Kommunismus befreien wollen, allzu schnell bereit, alles Böse hauptsächlich dem Kommunismus zuzuschreiben und zumindest das, was sich vor und nach 1945 ereignete, als ähnlich zu behandeln. Oft wird einfach die Kette von Ursachen und Folgen vergessen, einzelne Glieder werden aus ihr herausgerissen und ausschließlich diese bewertet. Gelegentlich ist auch das Fehlen eines gemeinsamen Wertesystems zu beobachten, dessen Gegenwart in der Geschichtswissenschaft wie in der Politik besonders wichtig zu sein scheint. Mit Bedauern beobachte ich hier und dort Moralvorstellungen ähnliche denen von Sienkiewiczs Kali[1] und das Hineinschlüpfen in die Rolle eines Beichtvaters, der Vergebung erteilt.
Andererseits muß die Ungleichheit der finanziellen Forschungsbedingungen und bei der Herausgabe historischer Publikationen unterstrichen werden. Trotz einiger Einschränkungen sind diese auf der deutschen Seite ohne Übertreibung um ein Vielfaches größer. Dies betrifft auch die Arbeitsbedingungen und das alltägliche Leben der Wissenschaftler, was unter den Bedingungen einer fortschreitenden Globalisierung oder Integration leichter miteinander verglichen werden kann und schmerzlicher empfunden wird. Auf polnischer Seite wird das Interesse an den Ergebnissen der deutschen Historiographie und auch an der deutschen Sprache, d.h. an der Fachliteratur und den deutschsprachigen Quellen, nicht geringer. Diese Tatsache ist einer besonderen Aufmerksamkeit würdig. Im Falle unserer Nachbarn muß ich den deutschen Kollegen Recht geben, die, vor allem bei den jüngeren Historikern auf beiden Seiten der Elbe, auf andere Interessengebiete als die deutsch-polnischen Beziehungen verweisen. Es gibt auch junge Kollegen, die die polnische Historiographie sehr gut kennen, aber noch immer dominieren Arbeiten ohne Kenntnis der Forschungsergebnisse in polnischer Sprache. Um dies zu ändern ist vor allem von unserer Seite eine größere Aktivität erforderlich.
Aber keine Illusionen! Unsere Landsleute haben das schon einmal gehört! Insgesamt handelt es sich jedoch um eine bedeutend längere Geschichte und eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Allerdings insoweit wenig gefährlich, als auf polnischer Seite auch in der Wissenschaft die Freiheit nicht immer mit Verantwortungsbewußtsein und Kontrolle, das heißt auch mit wissenschaftlicher Kritik, einhergeht. Leicht fällt es heute, eine Mittelmäßigkeit und einen wachsenden Opportunismus in wissenschaftlichem Gewand auszumachen, und diese Faktoren haben in den deutsch-polnischen Kontakten eine Bedeutung. Die Schwäche der wissenschaftlichen Kritik ist auf beiden Seiten ein aktuelles Problem.
Im Bereich von Methodologie und wissenschaftlicher Ethik sehe ich gleichfalls Ursachen für beunruhigende Erscheinungen wie auch bedeutende Anstöße für notwendige Veränderungen zum Besseren. In beiden Bereichen ist es zu einer Annäherung gekommen, notwendig sind dauerhafte, mindestens häufigere Kontakte, eine engere Zusammenarbeit und die gegenseitige Kenntnis der wissenschaftlichen Ergebnisse beider Seiten. Erforderlich sind auch Mittel für wissenschaftliche Konferenzen, Seminare, Kolloquien, archivarisch-bibliothekarische Forschungen außerhalb des Landes und gemeinsame deutsch-polnische Studienreisen durch die Regionen, deren Vergangenheit vielleicht eher der Gegenstand von Begegnungen als von weiteren Polemiken sein sollte. Notwendig sind ebenso Mittel für die Herausgabe wichtiger Arbeiten polnischer Historiker auch in deutscher Sprache.
Das ist selbstverständlich keine Methodik, sondern mit der wissenschaftlichen Methodik verwandte wissenschaftspolitische Komponenten. Zur Zeit gibt es aber keine Wissenschaftspolitik, insbesondere im Bereich der Geisteswissenschaften und der Geschichte. Wir haben zwar immer Gegenteiliges gehört: Es ist gut und wird noch besser! Solche Worte und frommen Wünsche sind aber nicht ausreichend. Mit Scham muß ich auf die Tatsache verweisen, dass Versuche gemeinsamen Handelns – wie die Ausarbeitung eines methodologischen Gerüstes und der Realisierung eines gemeinsamen Projektes, z.B. einer Veröffentlichung in der Art der »Pomorze – mała ojczyzna Kaszubów. Kaschubische-pommersche Heimat« (Gdańsk–Lübeck 2001) – hauptsächlich dank deutscher Mittel und des einfachen gesellschaftlichen Engagements von Historikern und anderen polnischen Geisteswissenschaftlern möglich sind. Die Tatsache, daß das Polnische Ministerium für Wissenschaft (KBN), 2001 kein Geld für den Druck der weiteren Bände der »Historia Pomorza« unter der Redaktion von Gerard Labuda und Stanisław Salmonowicz, ähnlich wie für die »Acta Cassubiana« des Kaschubischen Instituts bereitstellen konnte, schreit zum Himmel. Ist es nicht eine Schande, daß für kaschubische und pommersch-preußische Forschungen eher bei deutschen Stiftungen und Institutionen Mittel zu finden sind? Ich weiß selbst nicht, wie ich das nennen und was ich davon halten soll! Es bleibt nur eine tiefe Scham und Traurigkeit, daß Wissenschaft und Erziehung generell, und manchmal auch die Professoren und insbesondere die Geisteswissenschaften in der Optik unserer Politiker eine vernachlässigbare Größe darstellen, die der Aufmerksamkeit und einer anständigen Behandlung nicht wert sind. Ich teile die Meinung derjenigen, die behaupten, Polen sei ein reiches Land. Leider läßt sich jeder Reichtum leicht von unehrlichen Gruppen verprassen, die nicht wissen, was Arbeit ist, die keinen Begriff von organischer Arbeit, von dem Dienst an der Gesellschaft haben. Über den Kontext Politik – Wissenschaft – Geschichte mit Bezug auf die deutsch-polnischen Realitäten und die pommersch-preußische Region sprach vor einem Jahr anläßlich der Eröffnung des akademischen Jahres 2000/2001 Włodzimierz Stępiński aus Stettin in Gorzów Pomorski (Landsberg an der Warthe), das sich seit 1945 in seinem Namen als Teil Großpolens (Gorzów Wielkopolski) ausgibt. Seine Äußerungen haben eine gründliche Reflexion nicht nur von unserer Seite her verdient.
Ausgehend von der Methodik bin ich fast ins Moralisieren geraten. Leider haben schlechte Beispiele, abgeschwächte oder unklare Anforderungen, auch auf die »Neuen« und die neue Generation von Historikern, die im polnisch-deutschen Dialog engagiert sind, Einfluß. Auch unter den jungen – neben rechtschaffenen, arbeitsamen, ambitionierten und kreativen Wissenschaftlern – sehe ich Opportunisten und das Vortäuschen von Tatsachen. Besonders beunruhigend ist die Leichtigkeit, mit der einige ältere Kollegen zu einem neuen Standpunkt und sogar zu neuen Zahlen kommen, zum Beispiel bei der Schätzung der polnischen Verluste im Zweiten Weltkrieg, wie auch bei den Jüngeren das Fehlen jeglicher Kritik gegenüber diesen Erscheinungen. Es gibt im deutsch-polnischen Dialog noch zu viele Emotionen und zu viel handwerkliche Schwäche; zu wenig Ausdauer im Erschließen unterschiedlicher Quellen und ... kritische Beurteilungskraft. Man möchte sagen zu viel Naivität. Leider bemerke ich gelegentlich mehr Berechnung und eine Tendenz zur Bequemlichkeit. Auf der einen Seite ein Übermaß an scheinbar innovativen – fast ausschließlich bürokratischen – Lösungen, auf der anderen ein Mangel an Rechtschaffenheit bei der Ausnutzung der äußerst unzulänglichen finanziellen Mittel. Alle diese Übel kann man auf unsere innere Schwäche zurückführen, das Umfeld der Historiker... und der Politiker und die gesamte polnische Gesellschaft, die sich in einer Übergangssituation befindet, in der aufs Stärkste unterschiedlichste Winde wehen und gefährliche Ansteckungen herbeitragen. Unsere polnischen Schwächen vergrößern die Schwächen der deutschen Seite und umgekehrt. Aber mir kommt es nicht zu, mehr über die deutschen Schwächen zu sagen. Damit es anders werden kann, sind noch für lange Zeit größere Anstrengungen von polnischer Seite als von unseren Partnern nötig. Vor allem muß man jedoch darüber entschieden und deutlich sprechen. Ansonsten wird das Umfeld der Historiker von den geistigen Ergüssen á la Lepper und Rydzyk überflutet werden.
Zum Schluß möchte ich hervorheben, daß im Falle einer tatsächlichen professionellen Diskussion und Zusammenarbeit, bei Professionalität auf der polnischen Seite es keine größeren Schwierigkeiten gibt, ins Einvernehmen mit den deutschen Partnern bezüglich der Fakten und allgemeinen Erklärungen zu gelangen: 2x2=4! Ich zähle darauf, dass junge wie alte Historiker damit beginnen, aus der Geschichte zu lernen und einen größeren Respekt vor ihr bekommen – vor der Geschichtsschreibung der kommenden Generationen.
Einst vor vielen Jahren, noch vor unserer »samtenen Revolution«, führte man mir vor Augen, daß im Bereich der Kontakte zwischen Laien und Klerikern bei einem starken Einfluß der Gegenwart auf die Vergangenheit ich als Historiker größere Einflußmöglichkeiten als z.B. ein Bischof habe. Denn die Bischöfe fürchten nicht die Meinung der ihnen unterstellten Geistlichen, noch weniger die der einfachen Gläubigen:
»sie fürchten selbst den lieben Gott nicht, mit dem sie eng vertraut sind. Aber auch sie müssen mit der Geschichte rechnen...«
– Schade, dass ich heute sagen muß, dass dies vielleicht einmal so war. Die Mehrheit, sogar der Bischöfe, nicht nur der Politiker oder Historiker, erweist der Geschichte und der Geschichtsschreibung jenen Respekt nicht mehr, so als empfände sie ihn nicht mehr. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre neige ich dazu, in zweifelhaften Situationen, an welchen es mir nicht mangelt, jenen Recht zu geben, die behaupten, daß ein gemeinsamer Standpunkt polnischer und deutscher Historiker im Hinblick auf unsere gemeinsame Vergangenheit eine Utopie ist. Wir werden immer in der Geschichte unserer Nachbarschaft wie auch in der allgemeinen Geschichte eine polnische und eine deutsche Geschichte haben. So mag es auch gewesen sein. Das ist sogar fast sicher. Aber auf dieser Welt gibt es nichts auf ewig... Vielleicht kann es auch mehr Gutes geben, vor allem mehr gemeinsames Gutes, zu der auch bald möglichst die Geschichte zählen sollte...
[1] In Henryk Sienkiewiczs Jugendbuch W pustyni i w puszczy (Durch Wüste und Wildnis, 1911) vertritt die Figur des jungen Schwarzen Kali naiv-egoistische Moralvorstellungen; so z.B. die Auffassung, »wenn Kali eine Kuh stiehlt, ist es gut, wenn ihm eine Kuh gestohlen wird, schlecht« [Anm. d. Übersetzerin].