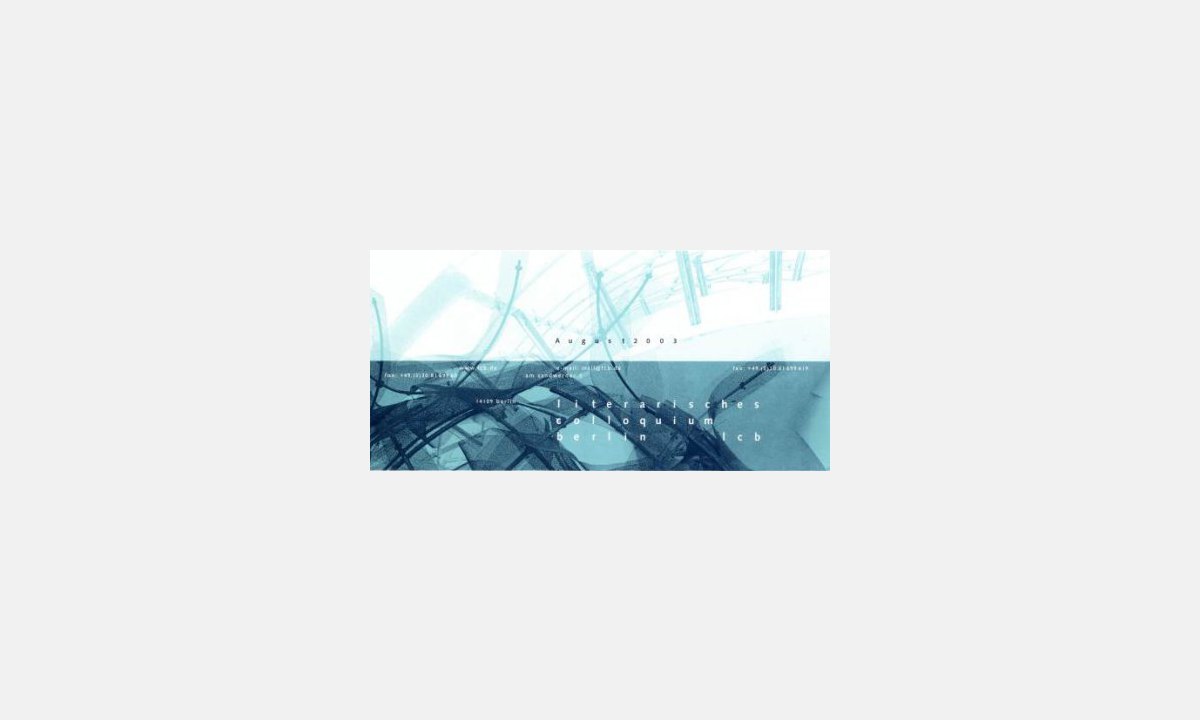Der literarische Abend diente im Rahmen der vom Literarischen Colloquium und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa veranstalteten »Sommerakademie für Übersetzer deutscher Literatur« – neben vielen anderen Lesungen – dazu, der internationalen Übersetzerschar vielversprechende deutsche Titel vorzustellen. Unter der sachkundigen Leitung von Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung, geriet der Abend mit dem lange tabuisierten, seit einiger Zeit jedoch enorm präsenten Thema Flucht und Vertreibung zu einem gelehrt-witzigen Gespräch über Erzählperspektiven, Erlöserphantasien und die partiellen Tode eines Autors.
Hans-Ulrich Treichel eröffnete den Abend mit einer Lesung aus seinem Roman Der Verlorene, der aus der Perspektive des pubertierenden Erzählers die groteske Suche seiner Eltern nach dem im Flüchtlingstreck verschollenen Bruder Arnold schildert. Doch die immer absurderen Untersuchungen von Verwandschaftsmerkmalen führen letztendlich ausnahmslos zu der Feststellung, dass die Familienähnlichkeiten mit dem anvisierten Waisenkind zwar nicht bewiesen, aber auch nicht ausgeschlossen werden können. Doch als die Familienrückführung am Ende in Gestalt eines Metzgergesellen tatsächlich in greifbare Nähe rückt, macht die Mutter einen Rückzieher – vielleicht ahnt sie inzwischen, dass eine Wiederauferstehung der Heimat besser durch das Suchen als durch das Finden vorgegaukelt werden kann. Die von Treichel gewählte Textpassage – die Familie unterzieht sich gerade einer Messung der anthropologisch entscheidenen Körperteile – ist exemplarisch für den Rhythmus des Romans: Die meist einfachen Sätze, Wiederholungen nicht scheuend und detailgenaue Beobachtungen aneinander reihend, erzeugen einen etwas erstarrten Tonfall, der, gekoppelt an die Erzählperspektive des Kindes, eine »paukerfaceartige Wahrnehmung« (Zitat Treichel) widerspiegelt. Der davon ausgehenden Komik konnte sich das teilweise verzweifelt schmunzelnde, teilweise lauthals lachende Publikum nicht entziehen.
Stephan Wackwitz, dessen gerade erschienenen Roman Ein unsichtbares Land Lothar Müller als eine »unzusammenfassbare«, langzeitorientierte Stammbaumrecherche bezeichnete, entfaltet die eigene Familiengeschichte um die Biographie des Großvaters, eines deutschnationalen protestantischen Pastors aus der Gegend von Auschwitz, der später nach Afrika auswandert. Das sich von dort ableitende »Auslandsdeutschtum« der Familie prägt auch den Autor, den es unter anderem nach Delhi und Krakau verschlug, und es bleibt nicht bei dieser einen Ähnlichkeit: Obwohl der Enkel respektive Autor eine politische Radikalisierung nach links vollzog, wird er dem Pastor im Verlauf des Romans immer ähnlicher (Wackwitz: »Wenn man nur auf den Tonfall hört, sind NSDAP und MSB gar nicht so verschieden.«) Wackwitz trug das Kapitel mit dem Titel Die Toten mit dem Motto »Tote auf Urlaub« von Eugene Levine vor, in dem er über die Beziehung zwischen seinem Großvater, in den 40er Jahren in Luckenwalde ansässig, und dem damals dort lebenden jungen Rudi Dutschke spekuliert. Im Gegensatz zu Treichel verleiht Wackwitz seinem Roman fast dokumentarischen Charakter, der durch die Einstreuung von Zitaten – u. a. von Rudi Dutschke, Ernst Bloch und Georg Lukács – unterstrichen wird. Die Stilisierung Dutschkes zum Heiland einer ganzen »namenlosen« (Zitat Müller) Generation, nämlich der von Wackwitz (Jahrgang 1952), sieht der Autor darin begründet und gerechtfertigt, dass der Linksradikale stets wie ein »reines Kind« (Zitat Wackwitz) handelte.
Als Treichel im anschließenden Gespräch die Dokumentarisierung als Handwerksmittel bei Wackwitz hervorhob, entlockte er diesem das kokette Geständnis, dass sein bisher einziger fiktionaler Roman auch zum einzigen Flop wurde – so, wie er die fiktionalen Romane Treichels liebe, so hasse er dieses Stilmittel für sich selbst. Die Vergötterung Dutschkes sah Treichel eher nüchtern als ein Medium bzw. eine Möglichkeit der familiaren Zusammenführung, der Erfüllung einer Sehnsucht. Wackwitz hob mit dem Ausruf »So soll Fiktion sein!« die Rollenprosa Treichels als bemerkenswert komisch heraus, da man ständig zwischen Lachen und Weinen hin- und herschwanke, während Müller in den vielen Zitaten in Wackwitz’ Roman durchaus ein Pendent zu fiktionalen Dialogen sah – laut Müller sei diese Verbrämung von wörtlicher Rede alte Tradition in Pfarrhäusern, wo die Schrift Macht über das Leben gewinne. Einig waren sich die beide Autoren zum Schluss, dass jeder erst eine Sache »zu Asche« (Zitat Treichel) werden lassen, sprich erst ein Stückchen sterben müsse, bevor er sich diesem Thema literarisch annehmen könne. Es leben die Toten auf Urlaub!
- Ein unsichtbares Land
Hans-Ulrich Treichel und Stephan Wackwitz lesen aus ihren Werken, die das Thema Flucht und Vertreibung behandeln
- Literarisches Colloquium Berlin