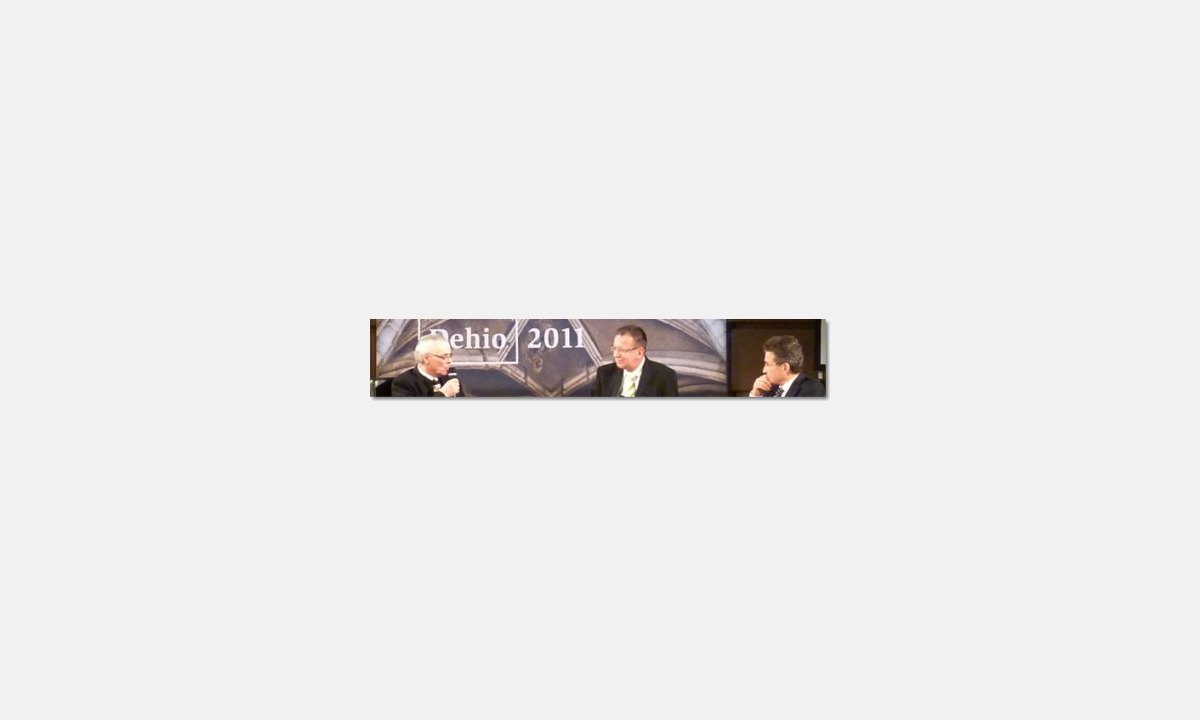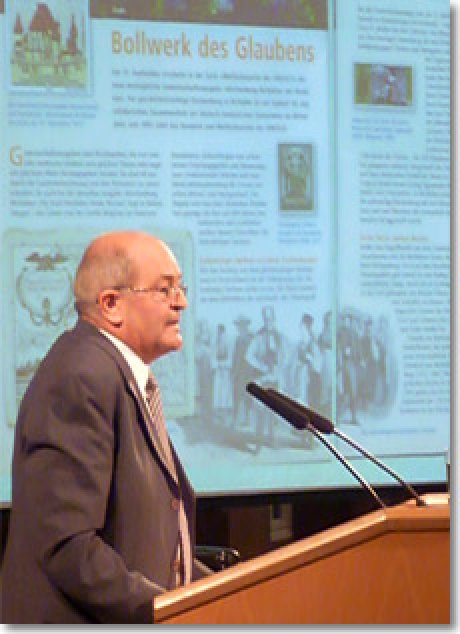Eine Begleitveranstaltung zum Georg Dehio-Kulturpreis 2011
Nachdem Mdg i.R. Winfried Smaczny, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Kulturforums östliches Europa die Teilnehmer und Gäste begrüßt hatte, stellte Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (Oldenburg) in seinem einführenden Vortrag »Kirche und Identität bei den Siebenbürger Sachsen – ein (kultur-)historischer Rückblick« die Stellung der Kirche in der Geschichte der Siebenbürger Sachsen von ihren urkundlich belegten Anfängen bis in die Gegenwart vor.
Die Deutschen, die vom ungarischen König angeworben wurden, sich in Siebenbürgen niederzulassen, waren Kaufleute, Handwerker und Wehrbauern, die ihre Pfarrer selbst wählen wollten. Sie erhielten vom Papst ihre kirchliche Organisation in einer freien Propstei, die nur dem Erzbischof von Gran unterstellt war. Die Eigenständigkeit und Besonderheit Siebenbürgens zeigte sich auch in der Reformation: Unter Vermeidung einer Spaltung nahm die gesamte deutsche Bevölkerung das lutherische Glaubensbekenntnis an, d.h. das Augsburgische Bekenntnis. In der Folgezeit war in Siebenbürgen der Glaube meist synonym mit einer Ethnie: Es gab etwa evangelische Deutsche, orthodoxe Rumänien, reformierte Ungarn. Die Religion trug damit wesentlich zur Identität der Siebenbürger Sachsen bei.
Unter den Habsburgern wurden deutschsprachige Protestanten wie die »Ländler« in Siebenbürgen angesiedelt. Im 19. Jahrhundert gelang es mit dem Hinweis auf die Vorschrift des Schulgesetzes für konfessionelle Schulen Deutsch als Unterrichtssprache beizubehalten (Siebenbürgen gehörte zum ungarischen Teil der Doppelmonarchie). Während es zur Zeit des Dritten Reichs zu einer Gleichschaltung der evangelischen Kirche kam, konnten die evangelischen Bischöfe während des Kommunismus’ die Selbstständigkeit bewahren und somit entscheidend zur Identität der Siebenbürger Sachsen in der Zeit beitragen.
Dem Gespräch von Prof. D. Dr. Christoph Klein, Bischof em. der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien, und Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber, Bischof em. der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, moderiert von Oberkirchenrat Dr. Johann Schneider, ging ein kurzes Impulsreferat von Bischof Klein voraus.
Er verwies eingangs auf den hl. Kirchenvater Augustinus, der zwischen der »urbs« und der »civitas« – zwischen den Gebäuden, aus denen die Stadt besteht, und den »Empfindungen, Anschauungen und Ritualen« der Menschen, die in ihr wohnen – unterschied und die Frage, ob der Geist der Bewohner in der Bauweise seinen Ausdruck finde. Denn die Stadt ist mehr als nur Schutz und Behausung, sie ist auch geistige Heimat, weswegen die irdischen Städte Sinnbilder für die »civitas Dei«, die Gottesstadt, seien. Für die Siebenbürger Sachsen sind die siebenbürgerischen Städte Teil ihrer »kollektiven Biographie«. Sie sind – und hier bezog sich Bischof Klein auf das Buch Kirche in der Zeitenwende von Bischof Huber – »sichtbare Werterepräsentanz«, die auf »gemeinsame kulturelle, ethische und religiöse Grundvorstellungen« verweisen und Zeichen dafür, »dass die Traditionskette nicht reißt«. Deswegen hängt in fast jeder Wohnung eines Siebenbürger Sachsen ein Bild seiner Kirche oder eines anderen kirchlichen Objekts, als Bekenntnis zu seiner Heimat.
Das Kulturerbe habe die wenigen Verbliebenen in Siebenbürgen zu großen Anstrengungen befähigt, den Aufbruch nach der Wende 1989, als die Mehrheit der Siebenbürger Sachsen nach Deutschland ging, zu leisten. Unterstützung und Hilfe für den Erhalt dieses Erbes komme vom rumänischen Staat und aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland. Der Schlüssel für die Lösung, wie das reiche kulturelle Erbe für die Zukunft erhalten werden könne, liege in der Bedeutung des »Erbes« als Rechtsbegriff: so sei der »rechtmäßige Erbe« die betreffende Gemeinde innerhalb der Gesamtkirche. Dort, wo es keine oder nur sehr wenige Gemeindemitglieder gebe, könne ein »Erblasser« eingesetzt werden, dass seien Kirchen anderer Konfessionen. In anderen Fällen können Kirchen, Pfarrhäuser und sonstige Bauwerke einer Institution übergeben werden, die sich verpflichte, diese zu erhalten (»Ersatzerben«). Verlassene Pfarrhäuser könnten beispielsweise in Sozialeinrichtungen umgewandelt werden. Bischof Klein schloss mit dem Hinweis auf das »Vätererbe«, das Patrimonium: bestimmte Kulturgüter beinhalten so hohe geistige und materielle Werte, dass sie der ganzen Menschheit gehören. Dazu zählen die Kirchenburgen, von denen einige in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurden. Für deren Schutz sei der rumänische Staat verantwortlich.
Das anschließende Gespräch über Kulturelles Erbe als Herausforderung und Chance der Kirchen begann mit einer Situationsbeschreibung der Kirchen in Berlin-Brandenburg und Siebenbürgern. Bischof Huber führte dazu aus, dass in der Nachkriegszeit bis zur Wende den Gemeindezentren Priorität zugestanden wurden. Diese sollten in einem modernen Stil errichtet sein. Inzwischen habe sich die Meinung geändert und die Menschen hätten die Ausstrahlung/Aura des sakralen Raumes wieder entdeckt. Viele der alten Kirchen seien wieder hergerichtet.
Bischof Klein bemerkte, dass in Siebenbürgen nur ganz wenige Kirchen völlig verloren gegangen seien, da sie von den Bewohnern der jeweiligen Orte stets als Wahrzeichen und Lebensmittelpunkt empfunden wurden. So setzte sich beispielsweise ein rumänischer Lehrer für den Erhalt einer evangelischen Kirche ein, da ihm deren Wert bewusst gewesen sei.
Auf die Frage des Moderators, wie es gelingen könne, Menschen dazu zu bringen, sich für den Erhalt eines Kirchengebäudes einzubringen, antwortete Bischof Huber mit dem Beispiel der Uckermark. Hier würde pro Jahr eine so große Anzahl von Bewohnern abwandern, dass vermeintlich viele Kirchen überflüssig seien. Aber es entstehen Fördervereine mit dem Ziel, die Kirchen zu erhalten. Dabei seien häufig rund zwei Drittel ihrer Mitglieder keine praktizierenden Christen. Er verwies auf die Kirche in Dannenwalde, die auf Initiative einer Frau, die die Kirche in ihrer Kindheit kannte und über ihren Zustand erschüttert war, wieder hergerichtet worden sei. Bischof Huber setzt sich für »offene Kirchen« ein, d.h. jeder, auch Nichtchristen, soll die Möglichkeit haben, die Kirchen besuchen zu können. Er verwies in diesem Zusammenhang lobend auf die Aktivitäten des Förderkreises »Alte Kirchen in Berlin-Brandenburg« und die Broschüre offene kirchen, brandenburgische kirchenladen ein.
Auf die Frage, wie man Menschen, die nicht religiös sind, einen Bezug zu Kirchen vermitteln könne, regte Bischof Huber einen Kurs in Kirchenführung an. Heute würde es nicht ausreichen, nur kunsthistorische Führungen anzubieten, vielmehr seien Einführungen in die Bedeutung und Funktion eines Gotteshauses, Altar, Taufe etc. notwendig. Religionslehrer sollten mit ihren Schülern Kirchen besuchen, um sie kennen zu lernen. Bischof Klein bemerkte, dass es in Rumänien keine oder kaum Atheisten gäbe, d.h. alle Menschen, auch die, die ihren Glauben nicht praktizieren, seien Christen und wüssten um die Bedeutung von Kirchen und ihrer Ausstattung, egal welcher Konfession sie nun angehören. Damit die Kirchen ohne Gemeinden oder zu kleinen Gemeinden nicht verwaisen, seien in Siebenbürgen Wallfahrtsgottesdienste eingeführt worden, d.h. die Gläubigen werden zu einem Gottesdienst in eine bestimmte Kirche eingeladen. Diese Gottesdienste, zu denen auch Rumänen kämen, wurden von den Leuten aus dem entsprechenden Dorf als Stärkung ihrer Position empfunden.
Bischof Huber sagte, dass er auf einer Reise nach Rumänien sehr viel gelernt habe. Inzwischen gebe es in Brandenburg so genannte Sprengelgottesdienste, die mit den Wallfahrtsgottesdiensten vergleichbar seien. Die Folge davon sei eine verstärkte Solidarität von Dörfern untereinander und das Gefühl, nicht nur eine kleine Gruppe zu sein. Im Unterschied zu Rumänien seien die Christen in Brandenburg eindeutig eine Minderheit. Bischof Klein führte aus, dass die evangelische Kirche in Rumänien zwar im Vergleich zu den anderen eine kleine Kirche sei, aber dennoch Einfluss auf die anderen habe.
Auf die Frage, welche anderen Nutzungsmöglichkeiten Kirchenräume bieten könnten, erinnerte Bischof Huber an die Situation der Kirchen in der DDR. Da diese staatsunabhängig gewesen seien, konnte sich in ihren Räumen eine neue Öffentlichkeit formieren. Kirchen als Ort für Musik sei eine andere Option. Der Dorfkirchensommer in Brandenburg sei erfolgreich, auch Ausstellungen, Lesungen, Diskussionen fänden in Kirchen statt. Statt eines Orgelmuseums sollten möglichst viele Orgeln in bespielbarem Zustand gehalten werden. Sinnvoll in diesem Zusammenhang sei es auch, Klavierschüler an Orgeln heranzuführen, um sie mit den Möglichkeiten dieses Instrumentes bekannt zu machen.
Bischof Klein verwies darauf, dass Außenminister Genscher bei seinem Besuch in Hermannstadt in der Stadtpfarrkirche gesprochen habe, da das der größte öffentliche Raum der Stadt sei. Der Bachchor von Hermannstadt setze seine Tradition fort, indem er sich für alle Interessierte geöffnet habe. Heute würden seine Mitglieder drei verschiedener Sprachgruppen und fünf unterschiedlichen Konfessionen angehören. Im Übrigen wurde der Bachchor von Hermannstadt mit seinem Leiter Kurt und Ursula Philippi 2003 mit dem Ehrenpreis des Georg Dehio-Kulturpreises für die Fortführung der Tradition ausgezeichnet.
Weitere Impressionen
Kirche und Kultur im Wandel
Siebenbürgen und Berlin-Brandenburg im Vergleich