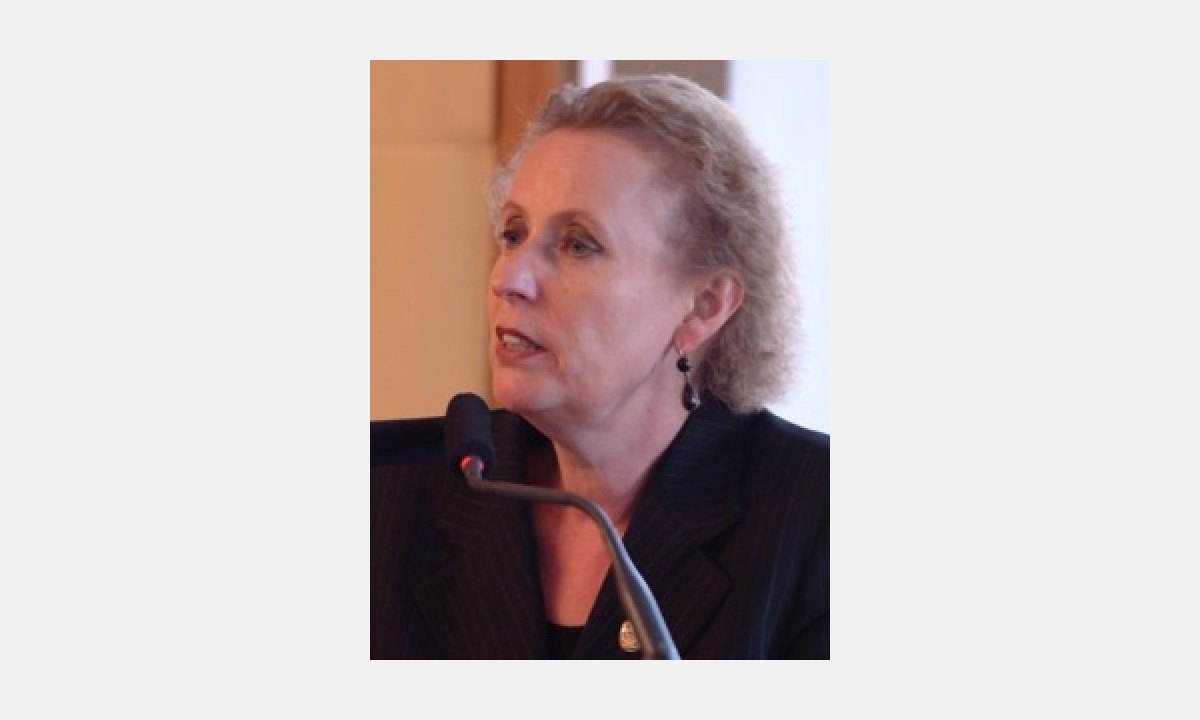Anrede,
es gibt in einer Sonderausgabe der amerikanischen Simpsons-Comics eine gezeichnete Version von Franz Kafkas Die Verwandlung, bei der sich das Oberhaupt der Simpson Familie, angelehnt an Gregor Samsa, in einen riesigen Käfer verwandelt. Um dem geistigen Urheber dieser Geschichte Tribut zu zollen, hatte der Comicautor im letzten Bild eine Tafel gezeichnet, auf der nur noch »Konec« stand – das tschechische Wort für »Ende«. Für einen Amerikaner, der Die Verwandlung in der englischen Übersetzung gelesen hat und weiß, dass Kafka in Prag lebte, scheint das ganz logisch zu sein. Vermutlich ahnt er gar nicht, dass Kafka auf Deutsch schrieb. Es ist ja sogar für diejenigen, die die Kultur des ostmitteleuropäischen Raumes aus der Nähe betrachten, manchmal unmöglich, die nationalen Identitäten auseinander zu halten – aber gerade das ist ja das Großartige, das zukunftsweisend Europäische daran.
Der Deutsch schreibende Jude Franz Kafka in Prag ist ganz sicher ein typischer Bewohner jener »Regionen mit doppelter und mehrfacher Kultur« von denen der polnische Kunsthistoriker Andrzej Tomaszewski spricht. Er beschreibt damit die Identität von Gegenden, in denen während der längsten Zeit ihrer Geschichte viele Völker und Angehörige vieler Religionen zusammen lebten. Gerade deshalb ist es manchmal so schwierig, Künstler und Kunstwerke einer oft erst viel später konstruierten nationalen Identität zuzuordnen. Der zweite Weltkrieg, der Holocaust, Flucht und Vertreibung, die ethnischen Säuberungen haben zu diesen Konstruktionen in den Lebensläufen geführt.
Während es in der chauvinistischen Politik immer wieder Versuche gibt, auseinander zu sortieren, was untrennbar zusammengehört, hat die Wissenschaft sich längst von jener engstirnigen nationalen Perspektive frei gemacht. Das Motto dieses Symposiums lautet »Gemeinsames Kulturerbe als Chance«. Worin könnte denn diese Chance bestehen? Nüchtern und allgemein gesagt: Vielleicht darin, die gemeinsame Zukunft vorzubereiten, indem man sich der gemeinsamen Vergangenheit vergewissert.
Doch keine Chance ohne Risiko. Das Risiko des gemeinsamen Kulturerbes besteht nicht nur darin, dass wie bei jedem Erbe ein Gezänk der Nachkommen um dessen Besitz ausbricht. Genauso droht die Gefahr, den Raum des östlichen Europas nachträglich zu einem Ort des konfliktfreien Zusammenlebens zu verklären.
Solche friedlichen Multikultiparadiese, wie sie naive Mitteleuroparomantiker herbei fantasieren, waren diese Gegenden auch nicht, bevor mit der Vertreibung und Ermordung der Juden die großen Bevölkerungsumschichtungen vor, während und im Gefolge des Zweiten Weltkrieges begannen. Ein Blick in die Literatur klärt auf.
Der polnische Schriftsteller Andrzej Szcypiorski hat in seinem Roman Die schöne Frau Seidenmann ein Bild jenes alten Mitteleuropa gezeichnet, das bei aller plastisch poetischen Präsenz, doch dessen dunkle Seiten auch nicht ausblendet. Gestatten Sie mir ein längeres Zitat:
»Hier und nirgendwo anders auf der Erde hatten sich die Schabbeskerzen mit trübem, gelblichem Glanz in den Scheiden russischer Säbel gespiegelt und polnische Hände hatten im Schatten des preußischen Weihnachtsbaums die Oblate gebrochen.Hier war der Mittelpunkt der Erde, die Achse des Weltalls, wo der Westen den Osten in die Arme nahm und der Norden dem Süden die Hand entgegenstreckte. Auf galoppierenden Steppenpferden, in den Traglasten auf ihren Rücken wanderten hier entlang die Bücher des Erasmus von Rotterdam. Jüdische Wägelchen, deren Deichseln in den Schlaglöchern brachen, streuten hier Voltaires Saatkorn aus. Im preußischen Postwagen fuhr Hegel nach Sankt Petersburg. Auf dieser Straße verneigte sich der Tatar gen Mekka, las der Jude die Thora, der Deutsche seinen Luther, entzündete der Pole seine Kerzen zu Füßen der Altäre von Tschenstochau und im Spitzen Tor zu Wilna. Hier war der Mittelpunkt der Erde, die Achse des Weltalls, die Anhäufung von Bruderschaft und Hass, Nähe und Fremde, denn hier erfüllte sich das Schicksal weit entfernter Völker.«
Bruderschaft und Hass, Nähe und Fremde und die Kerzen, die sich in den Säbeln spiegeln – alles ist nahe beieinander, nichts ist verschwiegen und gerade deshalb kommt Neugier auf diese verlorene Welt auf. Von der Haltung des Schriftstellers, der beschreibt und zugleich das Beschriebene noch einmal lebendig werden lässt, kann auch die Wissenschaft lernen. Deren Aufgabe ist es, Fakten zusammenzutragen, zu differenzieren, zu analysieren und die daraus gewonnen Erkenntnisse anschaulich zu machen. Dabei haben die vom Bund geförderten und auf diesem Symposium vertretenen Institutionen Vorbildliches geleistet. Aber wer forschen und aufklären will, der muss zuallerst erinnern, vor dem Vergessen bewahren und der Vergessenheit entreißen. Ihre Institutionen, meine Damen und Herren, bilden zusammen mit ähnlichen Einrichtungen in anderen Ländern ein reißfestes Netz gegen das Vergessen. Ihre Häuser sind wichtige Koordinaten der Erinnerung.
Wie Sie wissen, arbeiten wir auf europäischer Ebene an einem »Netzwerk Erinnerung und Solidarität«. Wir möchten einen starken Verbund von Werkstätten der Erinnerung installieren. Er sollte nicht nur auf Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert spezialisiert bleiben, sondern die Erinnerung an das nationalsozialistische Regime und die kommunistischen Diktaturen ebenso beinhalten wie die Suche nach den historischen Wurzeln des Nationalstaates und der Wahnvorstellung seiner ethnischen Homogenität.
Sie, meine Damen und Herren, wirken mit Ihren Institutionen schon jetzt in diesem Sinne, indem Sie an das erinnern, was nicht zu vertreiben war. Nach dem Krieg gab es genügend Versuche, eine deutschfreie Geschichte Osteuropas zu konstruieren. Das konnte nicht funktionieren.
Man konnte Kant nie aus Königsberg vertreiben, sowenig wie die schlesische Dichterschule aus Breslau. Gustav Mahler wird immer ein Böhme, Joseph von Eichendorff immer ein Schlesier und Philipp Otto Runge immer ein Pommer bleiben. Der Ortsname Agnetendorf wird immer genauso mit der Biographie Gerhart Hauptmanns verbunden bleiben wie Erkner und Kloster auf Hiddensee. Es ist erfreulich zu beobachten, dass dieses deutsche kulturelle Erbe heute von der dortigen Bevölkerung zunehmend als gemeinsames europäisches Kulturerbe ihrer Region angesehen und entsprechend gepflegt und erhalten wird. Es ist heute Teil einer neu entwickelten regionalen Identität, die von Beginn an übernational-europäische Züge aufweist.
Doch jene großen Namen, die ich eben genannt habe, stehen nur stellvertretend für all die ganz normalen Menschen, deren Namen heute nicht mehr ständig genannt werden, doch die in ihrem Alltagsleben durch Handel und Wandel, Berufsarbeit und Privatmühen ebenfalls dazu beigetragen haben, jenes gemeinsame Kulturerbe zu schaffen, dessen Chancen hier auf diesem Symposion diskutiert werden soll. An deren Flucht und Vertreibung soll eine große Ausstellung im Bonner Haus der Geschichte im Jahre 2006 erinnern. An der Vorbereitung sind viele der vom Bund geförderten Institutionen beteiligt, insbesondere die ostdeutschen Landesmuseen. Einen optimistischen Blick in die gemeinsame Zukunft können wir nur entwickeln, wenn uns vorher ein genauer Blick auf die düstersten Seiten der Vergangenheit gelingt.
Aber gerade deshalb muss vielleicht noch einmal gesagt werden, was ganz und gar nicht das Ziel unserer Erinnerungsarbeit sein kann. Es geht nicht darum, aus der Vergangenheit Forderungen für die Gegenwart abzuleiten. Günter Grass ist nur zuzustimmen, wenn er sagt: »Wie schon zu Beginn der siebziger Jahre bin ich auch heute der Meinung, dass wir zwar Land verloren haben, aber nirgendwo, in keinem Potsdamer Abkommen, steht geschrieben, dass die kulturelle Substanz dieser Provinzen und Städte in Vergessenheit geraten muss.« Wer nicht vergisst, ist deshalb noch lange kein Revisionist.
Zur Zeit des Kalten Krieges ist die Wissenschaft oft missbraucht worden, um Ansprüche zu legitimieren. Den Deutschen ging es darum, ihr Heimatrecht in den Gebieten, aus denen sie vertrieben wurden, auch mit Hilfe von Geschichtspolitik aufrecht zu erhalten.
Den Polen war daran gelegen, die Gebiete, in die man sie ja selbst zum Teil erst getrieben hatte, nachdem der polnische Osten russisch geworden war, als urpolnisch zu deklarieren. Von dieser Dienstmagdfunktion für die Politik hat sich die Wissenschaft lange schon emanzipiert. Die Sammlungen in Münster oder Lüneburg, in Ulm oder Gundelsheim, in Görlitz und neuerdings Greifswald sind Beweis für einen aufrichtigen Umgang mit der deutschen Kulturgeschichte in den ehemaligen Ostprovinzen. Das geschieht seit Jahren ohne Hass, ohne Aufrechnungen, ohne Ressentiments.
Das wurde nur möglich, weil auch die Politik sich gewandelt hat. Wenn die Bundesregierung seit Jahren die Erforschung und den Erhalt von Denkmälern der Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa mit nicht unerheblichen Mitteln fördert – den Erhalt von realen Denkmälern ebenso wie von Denkmälern im geistigen Sinne – so geschieht dies nicht, um auf dem Wege der Kulturförderung unterschwellig nationale Interessen geltend zu machen. Es geht vielmehr darum, sich gemeinsam mit unseren Partnern in Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien oder den baltischen Staaten mit unserer Geschichte auseinander zu setzen und einen Beitrag zur Versöhnung zu leisten, die gemeinsame Kulturgeschichte zu akzeptieren.
Das ist kein deutsches Wunschdenken, dem auf der anderen Seite keinerlei ähnliche Bestrebungen gegenüberstehen. Auch wenn die aktuellen Rufe nach Entschädigungen einen anderen Eindruck erwecken, so lehren mich doch meine Begegnungen mit Kulturministerkollegen aus dem östlichen Europa, dass man auch dort grundsätzlich willens ist, das gemeinsame Kulturerbe als Chance zu begreifen. Und auch Sie, meine Damen und Herren, erleben das in der Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem östlichen Europa. Ein Beispiel ist die Ausstellung Hausgeschichten des Donauschwäbischen Museums in Ulm, die den Wandel der Wohnkultur als Folge des Wechsels der Hausbesitze darstellt. Diese Ausstellung wurde gemeinsam mit Partnerinstitutionen in Ungarn und Rumänien entwickelt und in allen drei Ländern präsentiert.
Ein mittlerweile wieder weithin berühmter Glücksfall der frühzeitigen übernationalen Zusammenarbeit ist ein Denkmal, das erst in diesem Jahr auf die Unesco-Liste gesetzt wurde: Der Muskauer Park, auf polnisch: Park Muzakowski. Der Landschaftspark des Fürsten Pückler aus dem 19. Jahrhundert wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges durch die deutsch-polnische Grenze zerschnitten. In den späten achtziger Jahren begannen deutsche und polnische Denkmalpfleger mit seiner Restaurierung. Gemeinsam und erfolgreich bemühten sich Deutschland und Polen um die Eintragung ins Weltkulturerbe.
Die Teilung und Auftrennung des gemeinsamen Erbes hatte beiden Seiten nur Verlust gebracht. Der jetzt beschrittene Weg der Gemeinsamkeit ist ein Weg der Vernunft, auf dem beide Seiten gewonnen haben.
Das wieder neu erschaffene Ganze des Muskauer Parks ist – wie jeder Besucher bestätigen wird – mehr als die Summe seiner beiden Teile. Und er ist dadurch auch ein Symbol für das, was in Europa vor allem nach der EU-Erweiterung stattfindet. In solchen Grenz- und Verbindungszonen zwischen den Nationen (früher sagte man »Brückenlandschaften»), kann man etwas von der Idee und Praxis des aus einer komplizierten Vergangenheit entwickelten Europa erfahren. Hier können wir modellhaft unser aller kulturelle Zukunft erleben – mit ihren Risiken, aber vor allem auch ihren Chancen.
Ich danke Ihnen.
Gemeinsames Kulturerbe als Chance
Die Deutschen und ihre Nachbarn im östlichen Europa
Dr. Christina Weiss: Gemeinsames Kulturerbe als Chance
Der Wortlaut der Rede auf den Internet-Seiten der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien