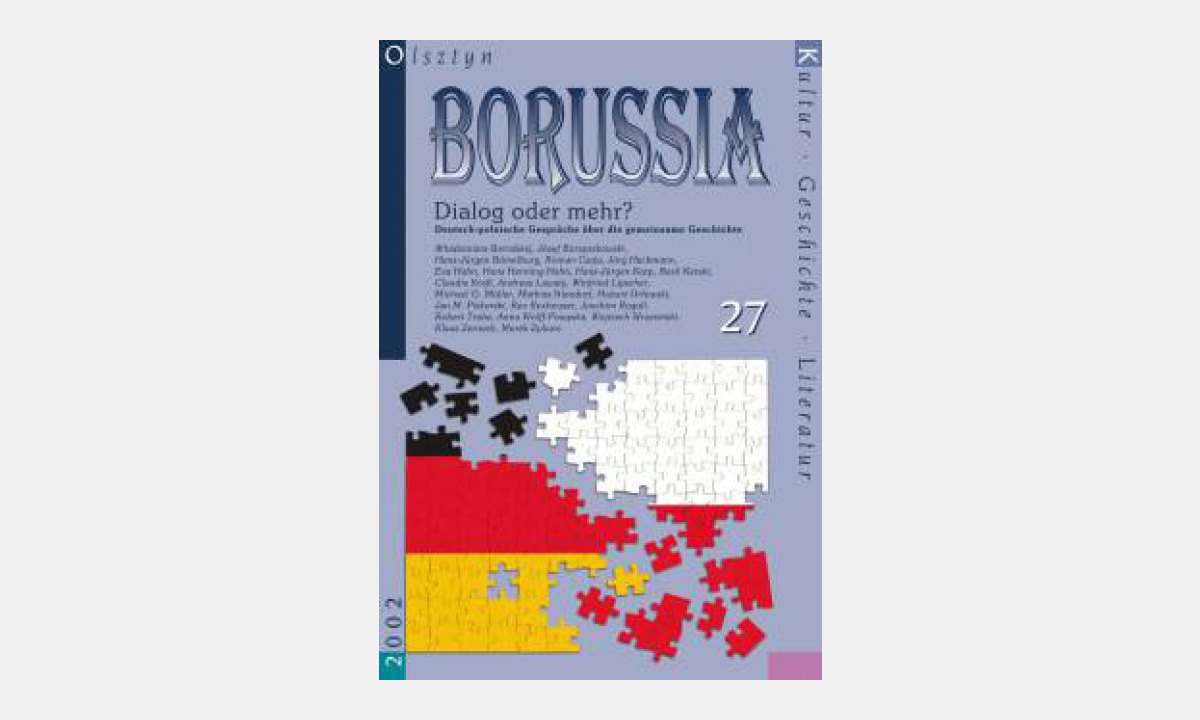Auffällig erscheint mir, dass es keinesfalls unbedingt aktuelle, politisch brisante Themen sind, die dazu beitragen, den Dialog zwischen deutschen und polnischen Historikern zu erschweren. So ist zum Beispiel die sogenannte Resolutionskampagne des Jahres 1998, während der die deutschen Vertriebenenverbände ein Junktim zwischen der Entschädigung der deutschen Vertriebenen und dem EU-Beitritt Polens formulierten und die polnische Seite hinter dem Hinweis auf ungeklärte Eigentumsfragen einen Anschlag auf die territoriale Integrität des polnischen Staates vermutete, relativ spurlos an den Fachhistorikern vorbeigegangen, die sich mit dem Themenkomplex Vertreibung/Zwangsaussiedlung beschäftigten (und das waren in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre gerade auf polnischer Seite eine ganze Menge).
Wenn wir nach Kommunikationsproblemen suchen, sollten wir daher auch nicht so sehr auf angebliche atmosphärische Störungen rekurrieren, die uns aus der aktuellen Tagespolitik erreichen, sondern uns eher die Frage stellen, welche Themenfelder durch die eigene Schuld der Historiker in den letzten Jahrzehnten bzw. in den letzten beiden Jahrhunderten »vermint« worden sind. Das sind vor allem Fragen, bei denen Historiker mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, nationale Besitzstände zu legitimieren. Wir fühlen uns heute in »postnationalistischer Zeit« allzu sicher, dass wir diese Rolle der Legitimationswissenschaft nicht mehr spielen. Aber auch wenn wir in diesem Sinne »politikfern« sind, so sind wir doch geprägt durch Fragestellungen und Methodik früherer Forschungsgenerationen. Also landen wir sehr oft ganz rasch wieder bei solchen Themen, die den Vorstellungshorizont dieser Generationen geprägt haben.
Kommunikationsprobleme entstehen nicht zuletzt dann, wenn »Kommunikation« bedeuten soll, dass man über ein Thema der gemeinsamen Geschichte mit deckungsgleichen Termini zu sprechen hat. Gerade bei den sogenannten »weißen Flecken« scheinen mir terminologische Diskussionen relativ unfruchtbar; wichtiger ist die gemeinsame Forschungsarbeit, durch die die Bestände der jeweils unterschiedlichen Erinnerung auf eine kompatible Grundlage gestellt werden. Und wenn selbst dann nicht gemeinsame Überschriften für diese Themen gefunden werden können, bedeutet das noch lange nicht, dass über solche Themen nicht kommuniziert werden kann, sondern bestätigt lediglich die auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten anzutreffende Erscheinung, dass sich das historische Gedächtnis jeweils sozial konstituiert und damit der Prägung durch die lebensweltlichen, politischen, nationalstaatlichen, aber auch den jeweils fachspezifischen Rahmenbedingungen unterliegt.
Kommunikationsprobleme sind jedoch nicht nur thematisch-inhaltlich bedingt. Trotz der seit dem politischen Umbruch seit 1989 möglich gewordenen Intensivierung der persönlichen Kontakte zwischen deutschen und polnischen Historikern, sollte man nicht vergessen, dass hier zwei sehr unterschiedliche Wissenschaftslandschaften aufeinandertreffen. Während meiner Mitarbeit an einem deutsch-polnischen Forschungsprojekt zum Schicksal der Deutschen in Polen in den Jahren 1945–1950 wurde mir diese Tatsache besonders deutlich. Verständigungsschwierigkeiten zwischen den deutschen und polnischen Projektmitarbeitern gab es über inhaltliche Fragen nur selten. Sehr viel problematischer war hingegen die Kommunikation über das jeweilige methodische Herangehen an den von uns bearbeiteten Themenkomplex. Die jeweils landesspezifische universitäre Ausbildung und Sozialisation bedingte, dass wir aus dem uns vorliegenden Quellenmaterial sehr unterschiedliche historische Synthesen formten – und zwar nicht, weil wir uns einer bestimmten Staatsräson verpflichtet fühlten, sondern weil wir in sehr unterschiedlicher Weise gelernt hatten, mit historischem Datenmaterial umzugehen. Hier wird noch lange Zeit ein geraumes Maß an »Übersetzungsarbeit« geleistet werden müssen. Das betrifft nicht nur die methodisch-theoretische Herangehensweise. Wer mit der Redaktion deutsch-polnischer Buchprojekte betraut war, weiß, dass auch Sprachkompetenz nicht vor Missverständnissen schützt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass vielleicht zu oft zu antizipieren versucht wird, wie die andere Seite wohl denken müsse. Man sollte bedenken, dass man als Historiker immer auch Teil des Beziehungsgeflechts ist, das man angeblich von außen objektiv betrachtet.
Für am sinnvollsten halte ich es, sich nicht nur auf die bilateralen deutsch-polnischen Beziehungen, schlimmstenfalls gemäß dem Raster einer auf nationaler Besitzstandswahrung ausgerichteten Historiographie, zu konzentrieren. Zur Überwindung alter, aus konventioneller Sichtweise herrührender Kommunikationsprobleme empfiehlt es sich, Fragenkataloge zu entwickeln, die andere Fragen stellen als die, ob Region X zum Zeitpunkt Y deutsch bzw. polnisch war. (Genauso anachronistisch wie diese Frage für viele Epochen erscheint, ist aber auch die Übertragung des Forschungsprogramms des Ideals von einem zivilgesellschaftlich organisierten Europa des 21. Jahrhunderts auf die Vergangenheit, die gegenwärtig manchmal zu beobachten ist.) Nationale Gegensätze – real oder konstruiert – sind zudem nicht die einzigen bzw. wichtigsten Faktoren, die Gesellschaften strukturieren. Die Frage nach der Konstituierung und dem Wandel von Geschlechterverhältnissen etwa macht deutlich, dass gesellschaftliche Ordnungen auch über andere Symbole hergestellt und befestigt werden. Weiterhin scheint mir eine stärkere Einbeziehung von Nachbardisziplinen sinnvoll. So kann man der traditionellen Rechtsgeschichte vielleicht vorwerfen, sich zu sehr an positiv gesetzten Normen zu orientieren, ohne gesellschaftliche Realitäten zu berücksichtigen. Andererseits bietet aber die Konzentration auf gesellschaftliche Ordnungssysteme wie Recht oder Religion die Möglichkeit, größere Querschnitte zu legen, die nationalstaatliche Sichtweisen überschreiten und Fragen nach Transferprozessen implizieren. Einen Beitrag zu einer solchen thematischen Öffnung kann auch der Ausbruch aus dem System althergebrachter geschichtsregionaler Zuordnungen leisten. Vielleicht gehört die deutsche Spezialität der »osteuropäischen Geschichte« tatsächlich abgeschafft. Manchmal habe ich das Gefühl, dass eine grundsätzliche Einbeziehung von westeuropäischer (inklusive deutscher) Geschichte vor normativen Fehlbewertungen schützen könnte.
Bei vielen deutschen Historikern der jüngeren Generation steht die grundsätzliche Abgrenzung gegenüber der traditionellen »Ostforschung« in ihren eigenen Augen außer Frage. Davon ausgehend ist man sich vielleicht der vielen Minenfelder, die es im deutsch-polnischen Historikerdialog immer noch gibt, gar nicht bewusst. Zudem sollte man sich immer fragen, ob die eigene wissenschaftliche Sozialisation nicht sehr viel stärker prägend ist als ein aktuelles politisches Bekenntnis. Die bloße Annahme, »politisch korrekt« zu sein, schützt noch nicht vor Missverständnissen mit polnischen Fachkollegen. Wenn man die deutsch-polnischen Beziehungen tatsächlich erst seit 1989 verfolgt, hat man vielleicht auch nicht den Grad an Sensibilität, der die Kollegen auszeichnet, die in Zeiten des Kalten Krieges ihre Kontakte nach Polen in einem sehr viel ungünstigeren politischen Umfeld aufbauen mussten. Andererseits sollte man aber auch generationsübergreifend akzeptieren, dass die Zeiten sich geändert haben. Es besteht nämlich durchaus die Gefahr, dass man sich darauf ausruht zu betonen, die deutsch-polnischen Beziehungen seien heute so gut wie nie zuvor, ohne wirklich etwas aus den neuen Möglichkeiten zu machen.
Besonders wichtig erscheint mir, dass für die jüngere deutsche Generation die Archivarbeit in Polen bzw. ganz Ostmittel- und Osteuropa einen hohen Grad an Normalität erreicht hat. Das hat zur Folge, dass man sich mit Themenfeldern beschäftigt, die bis zu einem gewissen Ausmaß bislang allein der polnischen Forschung zugänglich waren. Es scheint mir durchaus möglich, dass in solchen Fällen ein gewisses Misstrauen auf polnischer Seite herrscht. Dieses kann sich aus dem Zweifel an der sprachlichen bzw. landeskundlichen Kompetenz speisen, aber auch aus der Furcht, polnisches Quellenmaterial würde etwa zur Bestätigung alter deutschtumszentrierter Thesen in Stellung gebracht. Zwar waren die politischen Rahmenbedingungen, die etwa die Arbeit der gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchkommission vor 1989 umgaben, ungünstiger als die gegenwärtigen. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit für Historiker, die sich mit der deutsch-polnischen Geschichte beschäftigen, unkomplizierter geworden ist.