Nicht nur sein Breslauer Kriminalrat Eberhard Mock ist ein beharrlicher Ermittler, auch im Gespräch mit sich selbst schreckt Marek Krajewski vor »merkwürdigen Fragen« nicht zurück. Lesen Sie hier einen Auszug aus seinem Text Soliloquium, der anlässlich der Georg Dehio-Buchpreisverleihung 2016 ins Deutsche übersetzt wurde.
 Marek Krajewski 2016, © Wojciech Karliński
Marek Krajewski 2016, © Wojciech KarlińskiWährend dieses Interviews werde ich Ihnen viele Fragen stellen, die Sie bestimmt schon mehrmals beantwortet haben. Werden Sie sich nicht langweilen? Sind derartige Wiederholungen nicht zu lästig, monoton, inhaltslos?
Wissen Sie, ich habe jahrelang die lateinische Sprache an der Breslauer Universität unterrichtet. Jahrelang bekam ich die gleichen Fragen bezüglich der Verworrenheit der lateinischen Grammatik gestellt. Und diese endlosen Fragen haben mir Freude bereitet. Warum? Weil ich fähig war, sie zu beantworten. Diejenigen Fragen, die selten gestellt werden, sind ein Ergebnis des intensiven Nachdenkens, oft ein Versuch des Zuhörers oder Schülers, sich durch eigene Originalität hervorzutun. Und derartige Fragen sind entweder dumm oder höllisch schwer. Und diese Fragen mag ich nicht. Hingegen sind die oft gestellten Fragen vorhersehbar. Und ich mag alles, was vorhersehbar ist. Fügen wir hier auch hinzu, dass der Journalist die Antwort eigentlich schon kennt, da er sich auf das Gespräch mit mir gut vorbereitet hat. Warum fragt er also, wenn er die Antwort schon kennt? Weil er ein Vermittler zwischen mir und meinen Lesern ist – und die Leser kennen vielleicht die Antwort auf diese Frage nicht. So gebe ich ihnen Informationen, die für sie interessant sind, die sie sich wünschen. Auf diesem Wege wird meine Bindung an die Leser persönlicher.
Doch Sie erreichen bei Weitem nicht alle Leser. Es gibt viele Menschen, die gar keine Krimis lesen. Warum haben Sie also bewusst Ihr literarisches Gebiet nur auf dieses Genre begrenzt? Anders gesagt – warum schreiben Sie ausschließlich Kriminalromane? Wie begründet sich diese Entscheidung?
Ihre Frage berührt viele interessante Aspekte. Ja, ich schätze meine Leser sehr, ohne sie gäbe es mich so nicht. Wenn wir die Sentenz von Descartes »Cogito, ergo sum« umwandeln, sage ich: »Legor, ergo auctor sum« (Ich werde gelesen, also bin ich Autor). Ich weiß durchaus, dass mich keineswegs alle lesen werden! Es gibt allerdings eine immense Gruppe meiner Leser, die ich schätze und dank deren ich existiere, weil sie ihr mühsam verdientes Geld für meine Bücher ausgeben. Ich würde mich gerne nur auf diese Gruppe begrenzen, was aber nicht bedeutet, dass ich mich nicht freuen würde, wenn diese größer wäre. Ein Versuch, mich aller Leser auf dem Büchermarkt zu bemächtigen, wäre die Tat eines Narren oder eines Angebers. Ich möchte keiner von beiden sein.
Sie haben meine Frage jedoch nicht beantwortet. Warum haben Sie sich entschlossen, Kriminalromane zu schreiben?
Ich habe Ihre Frage nicht beantwortet, weil sie suggeriert hat, dass ich vor einem Dilemma gestanden hätte, vor einer Wahl, vor einer Entscheidung: Soll ich Kriminalgeschichten, Gedichte oder Romane schreiben? Und ich habe niemals einen Zweifel gehegt! Ich wollte schon immer Erzählungen schreiben, die einen Anfang, einen Kulminationspunkt und ein Ende mit Suspense haben. Ich dachte, diese Struktur ist in einem Kriminalroman am besten sichtbar. Ich habe nie über eine Alternative für Geschichten dieser Art nachgedacht …
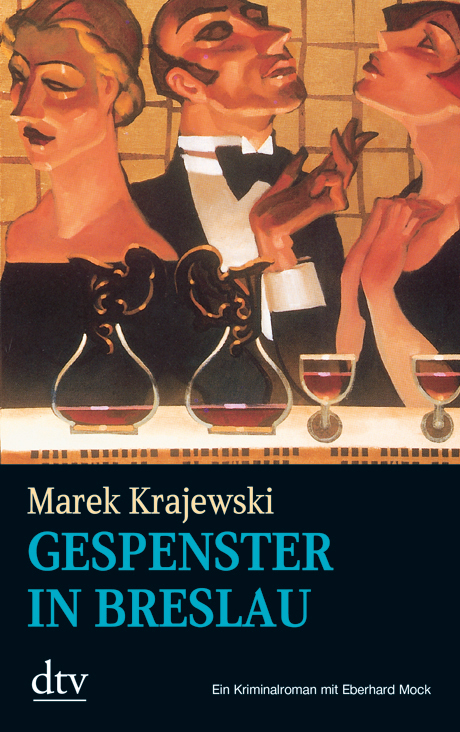
Sie möchten hier wohl etwas verbergen. Im Jahr 2006 haben Sie weit und breit verkündet, dass Sie sich von Mock und Breslau trennen und nun in einen neuen literarischen Fluss eintreten möchten – Sie beabsichtigten nämlich, eine Reihe von Erzählungen mit dem Titel »Die sieben Hauptsünden« zu schreiben. Sie haben also gelogen! Sie haben doch eine künstlerische Alternative gesehen – Geschichten mit gesellschaftlicher Thematik, derer Handlung sich hic et nunc abspielt.
Es gefällt mir sehr, dass Sie Latein sprechen. Weniger gefällt mir, dass Sie mir nicht aufmerksam genug zuhören. Ich habe gesagt, dass ich niemals beabsichtigte, andere Erzählungen zu schreiben als die mit einem Anfang, einem dynamischen Plot, einem Höhepunkt und einem Ende. Und genauso waren meine Erzählungen »Die sieben Hauptsünden« aufgebaut. Ich hätte sie kurz und knapp »klassische Narration mit Spannungsbogen« bezeichnen können. Im Wesentlichen war es nichts Anderes.
Sie mussten aber doch anders gewesen sein, da Sie sie niemals veröffentlicht haben. Vielleicht haben sie dem Herausgeber nicht gefallen? Vielleicht war es ihm lieber, weiterhin die Geschichten um Kommissar Mock zu etablieren, anstatt Krajewski als einen Autor des Standardgenres zu fördern?
Das stimmt, dem Herausgeber haben sie nicht gefallen, aber vor allem – ich selbst war von ihnen nicht überzeugt. Was noch schlimmer ist. Sie sind also in der Schublade gelandet, in einer Art literarischem Gefrierfach, wo sie auf bessere Zeiten warten. Vielleicht überbearbeite ich sie irgendwann und mache ein Bühnenstück daraus?
Nun gut, vielleicht waren die Erzählungen als eine klassische Narration keine Alternative. Sie standen aber bestimmt irgendwann vor einer anderen Alternative: Hochschularbeit oder literarische Arbeit, akademische oder schriftstellerische Karriere.
Das war ein riesengroßes Dilemma, eine wahre, folgenreiche Lebensentscheidung. Ich habe irgendwann begriffen, dass ich meine beiden Berufungen, nämlich Wissenschaftler und Schriftsteller, nicht gleichmäßig gut erfüllen kann, wenn ich die zwei Rollen gleichzeitig spiele. Die beiden Rollen gerieten immer mehr in einen unlösbaren Konflikt. Als Schriftsteller bekomme ich stets zahlreiche Einladungen – angefangen von Autorenlesungen bis hin zu längeren Stipendien. Diese Termine haben ununterbrochen mit meinen Vorlesungen an der Universität kollidiert. Andererseits ist es schwer, eine Habilitationsschrift mitten im medialen Tumult zu schreiben, zwischen einem permanent klingelndem Telefon und dem »Pling« des Computers, das wieder eine neue Mail ankündigt. Das Institut für Klassische Philologie und Antike Kultur der Universität Breslau entwickelt sich ständig, die Zahl der Studenten und der neuen Studienrichtungen wächst, die Kollegen müssen Überstunden machen. Ich wäre ihnen gegenüber nicht fair, wenn ich einen selbstgefälligen Literaten spielen und sagen würde: »Nein, ich mache keine Überstunden, weil es mit meiner literarischen Berufung nicht zusammen passt«. Das Verlassen der Uni war, glaube ich, nur anständig, und ein Widerstand gegen mein schlechtes Gewissen. Wissenschaftlich hätte ich nicht viel geschafft, und ich hätte mir immer wieder vorgeworfen, dass ich meine Verpflichtungen – vor allem die didaktischen – nicht ordnungsgemäß erfülle.
Sie bedauern also Ihren Verzicht auf die wissenschaftliche und pädagogische Arbeit nicht? Waren Sie nicht erleichtert, dass Sie Ihre Studenten nicht mehr mit der lateinischen Grammatik quälen, sie nach der Flexion befragen, die Syntax-Nuancen erörtern müssen – also eine Arbeit ausführen müssen, die bei der Mehrheit der Studenten unpopulär ist?
Zu verlangen, dass Menschen, die klassische Philologie wählen, alle Fächer des Studienprogramms mögen, wäre schwierig. Ich persönlich mochte keine Geschichte der griechischen und römischen Literatur, vor allem gewisse Zeiträume in ihrer Entwicklung, und Archäologie und Frühgeschichte (außer der Geschichte des Militärwesens) waren für mich eine Pein. Deswegen habe ich keinen Enthusiasmus von den jungen Menschen erwartet, als sie meine Vorlesungen in der »linguistischen Chemie« besuchten, denn so würde ich die historische Grammatik nennen. Nicht alle waren glücklich, als ich ihnen von der Folge langer und kurzer Silben, von den Konflikten der Morpheme oder dem Kampf zwischen Konsonanten und Vokalen erzählt habe, und noch weniger glücklich waren sie, als sie bei mir für die schwierige Prüfung der letzten zwei Jahre antreten mussten. Es gab aber in jeder Gruppe Personen, die mit leuchtenden Augen auf die für andere sterbenslangweiligen Aspekte reagiert haben. Es gab Studenten, die nach der Vorlesung länger geblieben sind und zum Beispiel eine Definition des lateinischen Akzents analysiert haben. Diese Studenten fehlen mir am meisten.
Und das akademische Milieu fehlt Ihnen nicht? Ich frage bewusst hinterhältig, denn man weiß ja, dass es ein narzisstisches, konfliktbeladenes, missgünstiges Milieu ist …
Sie verwenden Stereotype. In meinem Institut bin ich niemals auf Feindseligkeit oder Missgunst gestoßen, außer in einem Fall, von dem ich hier zum ersten Mal berichten werde. Eine gewisse Dame – als sie von meinem Uni-Rücktritt erfahren hat – hat mir eine skatologische Anekdote erzählt, deren Moral man mit dem sprichwörtlichen »Aufwachen im Nachttopf« vergleichen könnte. Also gab sie mir zu verstehen, ich befände mich in einer Situation, in der es zu spät für einen Schritt zurück sei. Ein Jahr später hat mich die gleiche Frau bei einer feierlichen Gelegenheit mehrmals als »Verräter« bezeichnet. Das war unangenehm, aber ich trage es ihr nicht nach. Ihre Reaktion ist allerdings eine Ausnahme, die die Regel bestätigt. Die Regel lautet: Im Gegenteil zu vielen wissenschaftlichen Milieus, war ich in meinem Institut von freundlichen und großmütigen Menschen umgeben. In diesem Institut arbeiteten und arbeiten immer noch meine besten Freunde. Wenn ich das prachtvolle, obwohl nach einer Sanierung schreiende, Gebäude in der Szewska-Straße 49 betrete, also das ehemalige Breslauer Polizeipräsidium, spüre ich Herzrasen. Ich atme genüsslich den charakteristischen Duft der Bücher ein. In den Fluren grüße ich herzlich meine Freunde – Philologen und Historiker. Ich fühle mich zu Hause.
Sie fühlen sich wie zu Hause: im Institut, in dem Sie jahrelang gearbeitet haben und in Wrocław, der Stadt, in der Sie geboren wurden und die Sie niemals für eine längere Zeit verlassen haben ...
2008 habe ich Wrocław für sechs Monate verlassen. Dieses halbe Jahr habe ich bei einem Literatur-Stipendium in der Schweiz verbracht.
Sie lieben also diese Stadt, ja?
Ja.
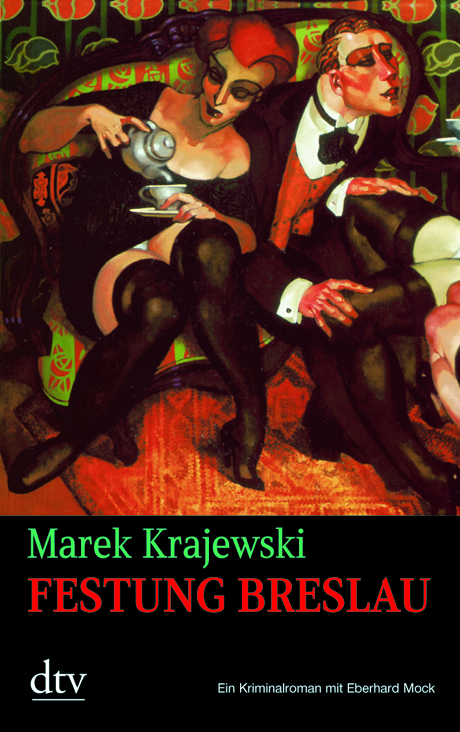
Diese Liebe merkt man in Ihren Romanen, wie manche behaupten. Aber ich sehe nichts davon. Sie verunstalten Breslau vielmehr, indem Sie daraus eine düstere, widerliche Kulisse für Ihr Theater des Todes machen. Sehen Sie hier keinen Widerspruch?
Sie stellen mir merkwürdige Fragen, die auf einer waghalsigen Logik aufgebaut sind. Wissen Sie was? Vor einigen Jahren in Dresden hat mir ein irritierter Leser Hass gegenüber Deutschen vorgeworfen. Er hat es so begründet, dass ich diese Nation in meinen Büchern als widerliche Mörder dargestellt hätte. Ich habe ihm damals geantwortet: Sehr geehrter Herr, bei mir sind fast alle Leute die Bösen, weil ich Kriminalromane schreibe! Wenn ich die Handlung meines Romans in Kamtschatka spielen ließe, wären die Tschuktschen oder Itelmenen auch als Verbrecher dargestellt, obwohl ich persönlich diesen Volksstämmen gegenüber vollkommen neutral bin! Das Gleiche betrifft den Ort der Handlung – Wrocław. Da ich düstere und pessimistische Krimis schreibe, deren Schauplatz das alte Breslau ist, wie soll ich diese Stadt beschreiben? Soll ich mich für sie liebevoll begeistern lassen? Ihre Schönheit betonen? Die Beschreibung mit hellem Licht intensivieren?
Natürlich müssen Sie es nicht tun, obwohl das wiederum von Ihrer stereotypen Denkweise zeugt. Es ist doch durchaus möglich, einen Thriller oder sogar einen Horror in einer hellen, schönen Szenerie spielen zu lassen; nur um zu erwähnen, dass Krimis auch im paradiesischen Kalifornien spielen können. Auch wenn Sie mich von Ihrer Liebe zu Wrocław nicht überzeugt haben, ist in Ihrem Schaffen eine Faszination für die niederschlesische Metropole deutlich spürbar. Hat das Gefühl eine persönliche Genese?
Ihre Fragen werden immer merkwürdiger. Kann eine Faszination einen nicht-persönlichen Charakter haben? Kann sie objektiv sein?
Ja, wenn sie mehrere Personen teilen. Sie wird dann für eine bestimmte Gruppe zu einer Gemeinsamkeit und erreicht dadurch ein gewisses Niveau an Objektivität.
Ich gehöre zu keiner Organisation von Wrocław-Liebhabern, ich weiß nicht, warum diese Stadt Menschen fasziniert, und ich möchte nichts zum Thema »Faszination des Kollektivs« sagen. Ich kann ausschließlich über meine persönliche Begeisterung reden.
Ich bitte darum.
Einst hat sich Stanislaw Lem im Tygodnik Powszechny zu meinen Texten geäußert. Er hat festgestellt, dass ich die geschichtlichen Strukturen meiner Stadt erreiche, vergleichbar mit einem Geologen. Abgesehen von der großen Ehre, die die wohlwollende Erwähnung durch diesen bedeutenden Schriftsteller für mich bedeutet, muss ich zugeben, dass meine Faszination für Wrocław durch die hier sichtbaren Zeichen der alten deutschen Kultur erweckt wurde. Die deutschen Schriftzüge an den Wänden, an den Eingangstüren der Häuser und sogar auf den Deckeln der Gullys, Trophäen wie Helme, Orden, Kronkorken und Flaschen, die während der Wanderungen meiner Kindheit in den dunklen Kellerkorridoren ergattert wurden – all das hat meine Begeisterung entfacht. Das Tabuthema der nichtpolnischen Geschichte der Stadt hat mich neugierig gemacht, mein Interesse entfacht und im Endeffekt diese Faszination verstärkt.
Heutzutage wird in Polen alles politisiert. Vor Kurzem hat ein Abgeordneter gegen die deutsche Verwendung des Toponyms »Breslau« protestiert. Dieser Politiker hätte bestimmt einen Herzinfarkt bekommen, wenn er erfahren hätte, dass Sie, ein Pole, den deutschen Namen von Wrocław in Ihren Romanen benutzen, mehr noch – dass das deutsche Toponym zu Ihrer Marke geworden ist! Haben Sie sich mit jenen Attacken auseinandergesetzt, dass Ihre differentia specifica die deutschen Ressentiments anheizen solle?
Ich verstehe nicht, warum der Name »Breslau« in den Titeln meiner Bücher dazu beitragen sollte.
Wären Sie so nett und beantworten meine Frage?
Ja, mir sind solche Vorwürfe begegnet.
Und wie haben Sie darauf reagiert?
Um eine Frage mit einer Frage zu beantworten. Ich wiederhole: Ich verstehe nicht, warum der Name »Breslau« in den Titeln meiner Romane dazu beitragen sollte. Wenn mein Disputant es mir explizit erklärt hat, habe ich ihm diese Frage auch beantwortet.
Na dann, ich erkläre es Ihnen. Die Politiker, die, gelinde gesagt, keine Enthusiasten von Ihnen sind, könnten sagen: Weg mit Krajewski, er schmeichelt sich bei den Deutschen ein!
Ich antworte wie ein Kind, das einen Vorwurf »Du bist doof!« endlos zurückweist: »Selber doof!« Es ist also nicht wahr, ich lobhudele den Deutschen nicht!
Warum verwenden Sie dann die deutsche Bezeichnung von Wrocław?
Das ist endlich eine sinnvolle Frage. Die Antwort lautet – aus Marketinggründen. Jahrelang wurde die deutsche Bezeichnung von Wrocław als ein Revisionismus verstanden und war bei uns verboten. Meine Verwendung dieses Namens war eine Provokation, deren Ziel es keineswegs war, historische oder politische Diskussionen zu erwecken. Auch hatte ich nie beabsichtigt, mich für die Normalisierung der polnisch-deutschen Beziehungen einzusetzen. Mir ging es nur darum, das Interesse der Leser zu provozieren. Das war's.
Nun haben Sie viele wohlwollende Deutsche enttäuscht, die Ihre Bücher für ein solches Zeichen der Normalisierung halten.
Als Schriftsteller schwebte mir nur ein Ziel vor – dem Leser spannende Unterhaltung zu bieten. Wenn es mir bei dieser Gelegenheit gelungen ist, etwas Gutes zu tun, freut mich das. Denn das Gute, das wir quasi nebenbei verursachen, darf uns doch nicht bekümmern.
Trotzdem verbreiten Sie unbewusst das Böse. Ich meine damit, dass Sie sich alle Mühe geben, mit dem Grauen und der Grausamkeit zu beeindrucken. Sind Sie mit mir einer Meinung?
Verzeihen Sie, ich möchte Sie nicht beleidigen, aber das Interview ermüdet mich inzwischen. Wenn ich darf, würde ich Sie gerne auf meine früheren Äußerungen verweisen.
Danke, dass Sie so ehrlich sind, obwohl dieses Verweisen in einem Interview nicht gerade elegant wäre. »Ich habe keine Lust, darüber zu sprechen, also lesen Sie es woanders nach?« Ist das höflich?
Sie haben recht. Ich antworte also. Das Grauen soll in meinen Lesern den Hass auf den Mörder erwecken.
Wozu das?
Damit der Leser, nach einer Szene, in der der Mörder/das Monster zu Recht bestraft wird, ergo stirbt, erleichtert durchatmen kann. Dann sagt der Leser, der das Monster hasst: »Geschieht ihm recht!«
Warum manipulieren Sie die Gefühle des Lesers?
Das ist keine Manipulation. Das ist einfach eine Rückkehr zu einer perfekt eingerichteten Welt, in der das Böse zwangsläufig bestraft wird. In verschiedenen Analysen von Kriminalromanen wird eben der Moment betont: Das am Anfang des Buches wegen eines Mörders verursachte Chaos wird zum Schluss, nach der Bestrafung des Mörders, wieder zur Ordnung. Und die Leser mögen es!
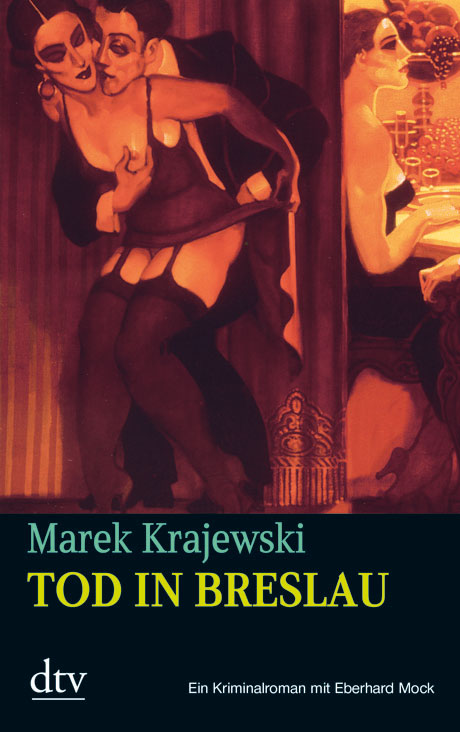
Sie versuchen also, nur das Publikum zu beeindrucken und Beifall zu heischen?
Durchaus, mit einer Ausnahme. Meinen ersten Roman habe ich nur für mich geschrieben. Und zwar so, dass ich ihn selbst als Leser lesen mochte. Auf dem polnischen Markt gab es damals keinen Krimi, der in den Realien des Vorkriegs-Breslau angesiedelt gewesen wäre. Ich habe beschlossen – und zwar immer noch ausschließlich für mich! – diese Lücke zu füllen. Als Tod in Breslau äußerst positiv aufgenommen wurde, ist mir bewusst geworden, dass es viele Leser gibt, die einen ähnlichen Geschmack wie ich haben. So schrieb ich also weitere Krimiromane in dem gleichen Stil, mit dem gleichen Protagonisten, in der gleichen Szenerie … Von diesem Moment an ging es nicht mehr um mich, sondern nur noch um meine Leser.
Übertreiben Sie nicht! Wenn die Leser so wichtig wären, hätten Sie ihre Wünsche berücksichtigt. Wie oft habe ich von meinen Bekannten Sprüche nach dem Motto gehört: »Hätte Krajewski nur einen modernen Krimi geschrieben, ihn in Krakau oder Warschau spielen lassen, wäre eine Frau die Protagonistin« usw. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie ähnliche Wünsche nicht gehört haben. Und Sie erfüllen diese Sehnsüchte Ihrer Leser ganz beharrlich nicht! Wie ist es also mit Ihrer vermeintlichen Zuneigung für die Leser?
Die Leser haben ihre Bedürfnisse, und ich erfülle sie. Aber wenn sie von mir verlangen, dass ich neue drastische Entscheidungen treffe, die allen meiner früheren Errungenschaften entgegenlaufen (andere Stadt, andere Zeiten, anderer Held), dann sage ich freundlich: Danke für diese interessante Anregung, ich werde es zu einem günstigen Zeitpunkt berücksichtigen, an dem ich wesentliche Änderungen in meinem Schaffen vornehmen möchte.
Wird ein solcher Zeitpunkt kommen? Haben Sie literarische Pläne, in denen ein neuer Protagonist vorkommt? Oder beabsichtigen Sie gar ein neues Genre?
Das ist ein Geheimnis. Bitte um die nächste Frage.
Gut, nun eine der am häufigsten gestellten Fragen: Wann werden wir den Film über Eberhard Mock und Breslau – die Stadt des Verbrechens – sehen?
Diese Frage sollten Sie dem Produzenten stellen. Ich habe alle Rechte an der Verfilmung meiner Bücher verkauft, und hier ist meine Rolle zu Ende.
Also verweisen Sie die Leser dieses Interviews auf den Produzenten, genauso wie Sie mich gerade auf Ihren Blog verwiesen haben? Sehr höflich …
Entschuldigen Sie. Ich weiß wirklich nicht, wie weit die Arbeiten an der Verfilmung meiner Romane gediehen sind. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt jemals Mock im Kino sehen werden.
Bedauern Sie also, dass die Verfilmung Ihrer Kriminalromane – wie Sie nun andeuten – immer weniger realistisch wird?
Nein, weil ich ein Stoiker und ein defensiver Pessimist bin – das bedeutet, ich bemühe mich, auf alle sogenannten Misserfolge vorbereitet zu sein.
Ich glaube nicht, dass es Ihnen nicht leid tut, dass Sie den Niedergang der Filmpläne nicht bedauern. Ein guter Film wäre doch ein Sprungbrett für den großen Erfolg!
Ich bedaure nur das, worauf ich einen Einfluss habe.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz
Eine gekürzte Fassung des Selbstgespräches ist im Magazin Blickwechsel des Jahres 2017 unter dem Titel Kulisse für ein Theater des Todes erschienen.