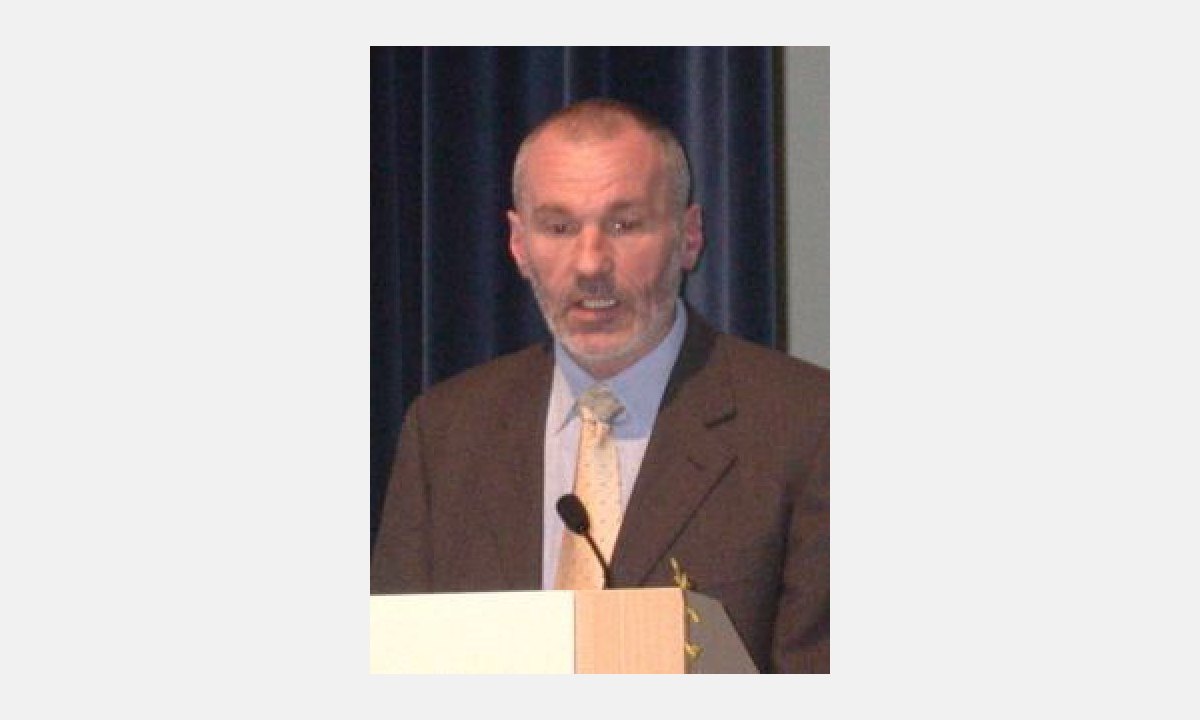Noch bevor der Sommer
sich neigt, werden die Abende
kühl. Streifiger Nebel steigt
aus dem Wasser. Viel
wird verschwunden sein.
Eine merkwürdige Konstruktion, dieser letzte Satz, anderthalb Verse, eine Bestandsaufnahme in der ersten Zukunft. Bestand aber hat in diesem Satz allein der Verlust, das Verschwinden, und die Zukunft, sie ist schon in der Gegenwart nur noch Vergangenheit. »Viel / wird verschwunden sein«. Ein deutscher Dichter aus Rumänien hat das geschrieben, der mittlerweile selbst nicht nur aus der rumäniendeutschen, sondern auch aus der deutschen literarischen Öffentlichkeit, in die er eingereist war, verschwunden ist.
Von mannigfachem Verschwinden muss reden, wer über jene »Wortreiche Landschaft« redet. Aber ist nicht gerade dieses das Thema aller Dichtung? Und wäre mithin nicht gerade diese Landschaft des Verschwindens zum Wortreichtum geradezu prädestiniert, eine Naturheimat der Literatur sozusagen?
Mutmaßungen und Spekulationen machen die Beschäftigung mit Dichtung bei aller Trostlosigkeit so reizvoll. Wer sich mit Literatur abgibt, darf keinen Trost suchen, er muss gerade der Trostlosigkeit etwas Tröstliches abgewinnen. Und das geht spekulativ am besten.
Halten wir uns aber vorerst bei den Fakten auf.
Ihren Anfang genommen hat die Geschichte jener Landschaft im 12. Jahrhundert, als deutsche Auswanderer dem Ruf des ungarischen Königshofes folgten und sich im Karpatenraum als »Wehrbauern« ansiedelten. Ihr Nachkomme Joachim Wittstock hat ihnen den Siedlerspiegel vorgehalten: »Ohne Bedenken gingen sie daran, die Landschaft zu verwüsten: sie hieben die Wälder nieder für hohe Gerüste und rissen die Berghänge auf und verwandelten sie in trostlose Steinbrüche«. Ihre sprachliche und kulturelle Bindung an die »alte Heimat« gaben sie dabei ebensowenig auf wie das durch Privilegien gestärkte Selbstbewusstsein einer solitären, aber standfesten kleinen Gemeinschaft. Die Poesie zählte nicht zu ihren vordringlichen Sorgen, und dem Schöngeist wurde vorerst keine Chance eingeräumt, das verschworene Gemeinwesen in seiner Standfestigkeit zu erschüttern. Mit liebevoller Ironie hat Joachim Wittstock sich – und uns – das alles reimlos zusammengereimt: »Sie waren so einfallslos, dass sie die Straßen möglichst gerade zogen und auch die Felder genau abgrenzten, und waren so ungemütlich, dass sie die Zeit nutzten, trotz des Weins, der sie berauschte mit Bildern dieser nicht unschönen Provinz«. Vergleichbar bodenständig im Wortsinn wie diese auch bei Wittstock zunächst Namenlosen, später dann Siebenbürger Sachsen genannten, waren auch die Schwaben, die im 18. Jahrhundert von den Habsburgern an der unteren Donau angesiedelt wurden.
Was hier wachsen sollte und wuchs aus jedem Körnchen Schweiß, das musste essbar sein und nicht lesbar. Siebenbürgische Schriftsteller des 17. Jahrhunderts wie Johann Gorgias oder Andreas Pinxner hielten es sogar für ratsam, ihre Erfolge in Deutschland zu Hause zu verschweigen, um nicht ob solcher Frivolitäten ins Zwielicht zu geraten.
Bei aller konkret wirtschaftlichen Verwurzelung in der und Bindung an die Scholle aber haben diese deutschen Bauers- und Bürgersleut über Jahrhunderte ein geistiges Rückgrat bewahrt. Es setzte sie in den Stand, sich auch in den nationalen Auseinandersetzungen mit der ungarischen Staatsnation zu behaupten, die zum Ende des 19. Jahrhunderts an Dramatik zunahmen.
1919/20 kamen Siebenbürgen und das Banat sowie die ebenfalls teilweise deutsch und deutsch-jüdisch geprägte Bukowina durch die Pariser Vorortverträge an Rumänien, das damit über Nacht zum Mehrvölkerstaat mit einem Minderheitenanteil von 28 (!) Prozent mutierte. Die damals 713.600 Deutschen in den drei bisher unabhängigen, ja einander eher fremden Siedlungsgebieten und etlichen anderen versprengten Flecken wurden damit zu einer Minderheit gebündelt. Dennoch verliefen die Entwicklungslinien, auch die literarischen, weiterhin parallel. Mit gebotenen Abstrichen lässt sich auf Sachsen und Schwaben übertragen, was Karl Kraus den Deutschen und Österreichern ins Stammbuch geschrieben hat: Was sie am meisten trennte, war die gemeinsame Sprache. Denn was und wie in dieser Sprache artikuliert wurde, war jeweils so unmittelbar an enge Gruppeninteressen gebunden und auf historisch-politische Ziele hin formuliert, dass es auch im binnendeutschen Sprachraum kaum Interesse weckte. Langsam nur setzte sich das Bewusstsein der Gemeinsamkeit in der Gefährdung durch. Poetische Kleinodien der – vor allem siebenbürgischen – Volksdichtung sind eine Ausnahme, fanden aber schon wegen der mundartlichen Fassung keine überregionale Verbreitung.
Der Widersinn der Geschichte ist von keiner dichterischen Phantasie zu übertreffen, und auch die deutsche Literatur in Rumänien trägt das Ihre zur Illustration bei: Zu kultureller Gemeinsamkeit »gediehen« sind die deutschen Gruppen und Grüppchen dort erst unter den zwiefachen totalitären Vorzeichen des 20. Jahrhunderts: in den Dreißigern im ideologischen »Anschluss« an das Nazireich, ab den späten Vierzigern dann unter der vielfach geschwänzten Fuchtel des Stalinismus, den Ceauşescu später mit liberal inszenierten Tricks in seinen nationalistischen Poststalinismus überleiten konnte. Von »Gedeih« kann natürlich nur bedingt die Rede sein, und wenn, dann nur in Verbindung mit »Verderb«.
Keine poetischen Gefilde also tun sich auf, die Schönheiten der sanften Hügellandschaft Siebenbürgens oder des Buchenlandes und des pannonischen Flach- und Berglandes an der Donau sind nur in Versen aufgegangen oder zu Kulissen von Dramen oder Romanen geronnen, wenn es galt, das eigene Anrecht darauf mit scharfer Feder gegen andere zu verteidigen oder die deutschen Landsleute in diesem Rechtsverständnis, Anrechtsverständnis zu bestätigen. Selten schwingt sich der schöpferische Elan deutscher Dichter aus diesen »nicht unschönen Provinzen« über das hinaus, was ihrem Völkchen ihrer Ansicht nach politisch und moralisch, ökonomisch und ethisch frommte. Ein volkserzieherischer Impetus zieht sich als Grundton durch ihre Werke, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg klingt er langsam ab oder schlägt gar um ins ästhetisch reizvolle Eingeständnis eigener Ratlosigkeit vor der Zeitgeschichte. Als Wortführer und Sachwalter ihrer Minderheit haben die sächsischen und schwäbischen Autoren den Versuchungen der Heimattümelei und der Deutschtümelei selten die Dichterstirn zu bieten vermocht, zumal liberaler Geist als Stabilitätsrisiko gelten musste und nur volkstümlich affirmative schriftliche Äußerungen der Volksseele zuträglich erschienen.
Erste literarisch gelungene Versuche etwa eines Adolf Meschendörfer, zu Anfang des 20. Jahrhunderts aus derlei Verbindlichkeiten auszubrechen und dabei auch über siebenbürgische Burgmauern und Gartenzäune hinweg zu lesen und zu schreiben, haben nicht mehr verhindern können, dass sich die deutsche Minderheit Rumäniens unter der Führung der »Deutschen Volksgruppe in Rumänien« 1940 blindlings an das nationalsozialistische Deutschland kettete. Dieser unselige Pakt korrumpierte ihr Selbstverständnis nachhaltiger, als sie zu erkennen vermochten oder bereit waren. Das nach dem Krieg durch Deportation und Enteignung erlittene Unrecht aber hat das Nachdenken über eigenes Fehlverhalten oft verdrängt.
Hatten sich die Regionalliteraturen bis dahin weitgehend selbst genügt und in dieser Genügsamkeit gegen liberale oder gar moderne Anmutungen von außen verschlossen, wuchsen sie nach 1948 zur rumäniendeutschen Literatur zusammen, die zuvörderst durch politisch unbelastete jüdische Schriftsteller aus der Bukowina wieder öffentlichkeitsfähig gemacht wurde – sofern der Bukarester Proletkult eine Öffentlichkeit zuließ. Die Zumutungen des stalinistisch dirigierten Kulturbetriebs erzeugten einen Druck, der einen gewissen überregionalen Solidarisierungseffekt zeitigte.
Nicht zu übersehen und nicht zu unterschätzen ist dabei, dass zu jenem Zeitpunkt keiner der Schreibenden, wie alt er auch sein mochte, auf irgendeine Erfahrung oder gar Erkenntnis in Sachen »Diktatur des Proletariats« oder »Sozialistischer Realismus« zurückgreifen konnte. So hoffte Erwin Wittstock noch 1954 allen Ernstes, dass sein Roman über die Deportation der Siebenbürger Sachsen in die Sowjetunion im kommunistischen Rumänien erscheinen könnte – dass also unter dem politischen Diktat der Täter ein Roman über die Opfer publiziert werden könnte: »Für die Heimat in redlichem Beisammenstehen jedes Opfer zu bringen, wer immer uns beherrscht, ist der einzige Weg, dem strengsten Beherrscher Vertrauen abzugewinnen. Dies ist die höhere Pflicht ...?« So steht es da: »dem strengsten Beherrscher Vertrauen abzugewinnen ...« Januar ’45 oder Die höhere Pflicht heißt der Roman, 1998 erst wurde er nach langen Peripetien des Manuskripts durch die Giftschränke der Securitate von den Erben des Schriftstellers herausgegeben. Oder: 1956 treffen sich in Hermannstadt in einem Privathaus mehrere Autoren deutscher Sprache, um zu ratschlagen, wie man sich den neuen politischen Gegebenheiten zu stellen habe. Der beteiligte Georg Scherg erzählt: »Vermutlich wusste noch keiner von uns, wer oder was die Securitate war.«
Sie alle, Georg Scherg in vorderster Reihe, sollten es alsbald erfahren. 1959 verurteilt ein rumänisches Militärgericht fünf deutsche Schriftsteller willkürlicher Wahl zu insgesamt neunzig Jahren Haft wegen angeblich regimefeindlicher Umtriebe. Zu etwa der gleichen Zeit werden weitere Schauprozesse gegen vorgeblich Aufmüpfige inszeniert. Nach den Unruhen in der DDR 1953 und in Ungarn 1956 soll, so der Wille Moskaus und seiner Vasallen, Totenstille hergestellt werden im Land. Betroffen sind unverhältnismäßig viele Minderheitler. Bei den Deutschen gesellt sich zur Erfahrung der Kriegsbeteiligung (meist in der Waffen-SS), der Gefangenschaft und der Deportation in sowjetische Zwangsarbeitslager nun das Spektrum des Gedankenterrors. Die Saat der Verunsicherung und des totalitären Schreckens, die panische Verschwiegenheit und das Verschweigen von Täter- wie Opfertraumata bis ins Innerste von Familien ist bis heute nicht in aller Konsequenz ausgeräumt. Immer wackliger wird der Boden, auf dem das Selbstbewusstsein der Minderheit gründet.
Halten wir uns an den Fakten fest:
In den 60er Jahren sterben die Galionsfiguren der deutschen Zwischenkriegsliteratur in Rumänien: 1962 der Siebenbürger Erwin Wittstock, 1966 der Bukarester Oscar Walter Cisek, 1967 der Bukowiner Alfred Margul-Sperber. Zugleich wandern mit Andreas Birkner, Hans Bergel und Paul Schuster die ersten bedeutenden Nachkriegsautoren in die Bundesrepublik Deutschland aus.
Schicksalsträchtig in mancherlei Beziehung kommt das Jahr 1971 daher: Es erscheinen erstens Erwin Wittstocks Nachlassroman Das Jüngste Gericht in Altbirk, ein nur scheinbar versöhnlicher Abgesang auf das sächsische Gemeinwesen, zweitens Anemone Latzinas Lyrikband Was man heute so dichten kann, die Initialzündung eines kleinen Feuerwerks rumäniendeutscher lyrischer Moderne – und drittens Nicolae Ceauşescus Thesen zur Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit, der kulturellen und erzieherischen Tätigkeit, die den ersten Frost des poststalinistischen Eiszeitalters, der »Goldenen Epoche«, ankündigen.
Junge Banater Schriftsteller gründen 1972 die Aktionsgruppe Banat, deren naiv-marxistische Unbotsmäßigkeit erst nach drei Jahren brutal reprimiert wird, aber erst recht lange nachwirkt. Germanistisch geschulte Kritiker der Geburtsjahrgänge 1941-1945 fordern in der unverhältnismäßig weitläufigen rumäniendeutschen Publikationslandschaft Professionalität ein, die von literarisch gebildeten Germanistikabsolventen auch geleistet wird.
Die rumäniendeutsche Literatur sprüht und funkelt, während das Land in wirtschaftlicher Misere und ideologischer Düsternis versinkt – nicht das einzige Paradox dieser Landschaft, die an Widersinn fast noch reicher ist denn an Worten. Die rumäniendeutschen Dichter jubeln dem Staatsapparat ihre Produkte unter. »Zu den Paradoxien eines balkansozialistischen Absurdistan gehört es ..., dass viele ihrer oppositionellen Texte trotz verschärfter Zensur in Rumänien erscheinen konnten«, sagt dazu im Rückblick Peter Motzan, einer der maßgeblich beteiligten Kritiker. Wieso? Wieso konnten in Rumänien deutsche Texte erscheinen, die etwa in der DDR nicht einmal das Zwielicht des Verlagslektorats, geschweige denn das der Druckerpresse hätten erblicken dürfen?
Die Gründe sind ebenso vielfältig wie widersprüchlich: Zum einen waren das Texte in deutscher Sprache, und ihr widerständiger Subtext erschloss sich den rumänischen Zensoren und anderen Entscheidungsträgern, denen sie erst übersetzt werden mussten, nur bedingt. Ein Minimum an Zusammenhalt zwischen Autor, Lektor und Übersetzer/Übermittler – und dieser Zusammenhalt wuchs direkt proportional zum allgemeinen Elend oder war gar durch Personalunion gegeben – genügte, um Subversivstes »durchzubringen«. Nichts wurde so heiß gelesen, wie es geschrieben war. Zum anderen hatte das Regime wohl begriffen, dass die Politik den »eigenen« Deutschen gegenüber die anderen Deutschen »drüben« zum Wohlwollen bewegen und so die liberale Fama des rumänischen »real existierenden« Sozialismus in der westlichen Welt aufpolieren konnte. Innenpolitische, gar nur kulturelle Freizügigkeit dieser Minderheit gegenüber kostete schließlich nichts, brachte aber einiges ein. Man hatte ihr und ihren Wortführern zwar übel mitgespielt, aber ihre schläfrige Loyalität hatte Bestand. Sie gründete auf der Tatsache, dass diesen Menschen in letzter Instanz das Schlupfloch gen Westen offenstand und sie deshalb aller Voraussicht nach nicht »hysterisch« agieren oder reagieren würden.
Spekulationen sind in dieser Grauzone kein Grenzen gesetzt, fast vergnüglich muten sie heutzutage an, damals jedoch war der Aufenthalt in jener Zone denkbar gefährlich. Auf sich genommen hat diese Gefahr jeder, der nicht nur schrieb, sondern auch publizierte, die jungen Nachkriegsschriftsteller jedoch sind ihr unbefangener, gewissermaßen ironisch entgegengetreten, denn: »Die Angst war eine Erzählung der Eltern.« So Richard Wagner, der zugleich freimütig bekennt, den langen repressiven Atem, vielmehr Odem des Systems unterschätzt zu haben: »Wir waren dumm.«
Ernste Spiele wurden gespielt in diesem »Betrieb«, der eigentlich zwischen den Böden der ideologisch unterhöhlten Wirklichkeit mäandrierte. »Wo verliefen die Kraftlinien des wirklichen literarischen Lebens?« fragt heute Gerhardt Csejka, der damals mitten in diesem Leben stand. Eine schlüssige Antwort bleibt einer Literaturgeschichte überlassen, die Einblick erhält in die vielen Hohlräume, sofern sie noch nicht zugeschüttet worden sind. Uns bleiben Mutmaßungen – und die Freude über das trotz allem Gelungene. Gäbe es nicht die Erfolge der vielen Protagonisten im binnendeutschen Betrieb, auf dem deutschsprachigen Büchermarkt, die nicht nur dem »Exoten-Bonus« (Peter Motzan) zuzuschreiben, sondern offenbar von Dauer sind, müsste es mit der gelinde sarkastischen Feststellung von Ernest Wichner sein Bewenden haben: »Rumäniendeutschland gibt es nicht mehr, doch so lange es existierte, war es jene nebulös-imaginäre Kopf-Landschaft, die den Ort einer spezifischen Literatur markierte«. Aber diese Erfolge gibt es, und einer davon ist diese Ausstellung.
Ihr Reiz liegt nicht zuletzt in den Fragen, die sie eröffnet, ohne sie zu beantworten. Wie lange gehört ein Mensch zu einer Minderheit, auch wenn es sie nicht mehr gibt? Wie lange bleibt ein Mensch Gefangener einer Diktatur, auch wenn es sie nicht mehr gibt? Lebenslänglich? Und wieso ist eine lebenslängliche Gefangenschaft literarisch so virulent wie bei Herta Müller? Oder bei Hans Bergel oder Eginald Schlattner? Wieso muss einer schreiben, gerade wenn er nicht publizieren kann? Und wieso muss er erst recht schreiben, wenn er publizieren kann? Und wieso kann er es dann vielleicht nicht mehr?
Kehren wir zurück aus den Meta-Gefilden in die »Wortreiche Landschaft«, in der, mehr noch, in die einst Rolf Bossert sein Wesen getrieben hat. Einiges an Antwort steckt in einem so leichten wie herben, so seiltänzerischen wie abgründig abgrundbewussten Gedicht, erschienen im sozialistischen Klausenburger Dacia Verlag 1978:
»aus meinem leben24. september 1977
ich bin verheiratet und habe zwei kinder meine frau lehrt deutsch als fremdsprache ich auch wir bewohnen zwei zimmer einer dreizimmerwohnung das kleine zimmmer ist sieben komma siebenundachtzig quadratmeter groß das große zimmer ist neun komma achtundachtzig quadratmeter groß das größte zimmer der wohnung ist vierzehn komma neunundsechzig quadratmeter groß wir wohnen nicht darin es ist abgesperrt meist steht es leer aber im winter wohnt ein altes ehepaar in dem zimmer so sparen die leute holz bei sich zu hause auf dem dorf oft kommen am wochenende unbekannte familien mit kindern die höhenluft tut den kleinen gut die dreizimmerwohnung liegt im schönen luftkurort buşteni küche badezimmer und klo werden von vielen personen benützt nur der balkon liegt an der sonnenseite er gehört zum dritten zimmer ich darf ihn nicht betreten
ich habe an das wohnungsamt geschrieben
an den volksrat
an die zeitung
ich habe bei vielen genossen vorgesprochen
nun schreibe ich ein gedicht
ich habe unbegrenztes vertrauen in die macht der poesie21. dezember 1977
dieser text ist unveröffentlicht gestern bekamen die alten zwei zimmer in einer villa wir bekamen den schlüssel zum dritten zimmer womit bewiesen ist dass auch unveröffentlichte gedichte die realität aus der sie schöpfen verändern können ich werde noch gedichte schreiben«
Rolf Bossert schreibt keine Gedichte mehr. »Viel wird verschwunden sein«, hat ein Freund später geschrieben. Darum noch einen Blick in Joachim Wittstocks Siedlerspiegel, zum Abschluss, zum Schluss:
»Ihre Wehrmauern und Türme waren leicht abgeschrägt, und wenn es schneite, zog der Schnee sich Stein für Stein empor: bis zum Dach waren dann Dörfer und Städte weiß und sind im Winter fast völlig verschwunden.«
Georg Aescht - Kurzbiographie
- 1953 geboren in Zeiden (Codlea), Siebenbürgen Studium der Germanistik und Anglistik in Klausenburg (Cluj-Napoca)
- 1976-1983 Lehrer für deutsche Sprache und Literatur am deutschen Gymnasium in Klausenburg
- 1984 Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland
- 1984-1991 Korrektor in einer Setzerei
- seit 1991 Redakteur der Zeitschrift »Kulturpolitische Korrespondenz«, lebt in Bonn
Georg Aescht hat sich um die deutsche Literatur, insbesondere die zeitgenössische Literatur deutscher Sprache aus Rumänien, verdient gemacht. Aescht ist Autor literaturhistorischer Beiträge für Lehrbücher deutschsprachiger Gymnasien in Rumänien und hat zahlreiche Aufsätze in literaturwissenschaftlichen Fachpublikationen veröffentlicht. Daneben hat er sich als Herausgeber, Literaturkritiker und Übersetzer aus dem Rumänischen, Englischen und Französischen einen Namen gemacht.
Wortreiche Landschaft
Deutsche Literatur aus Rumänien – Siebenbürgen, Banat, Bukowina. Ein Überblick vom 12. Jahrhundert bis zur Gegenwart.